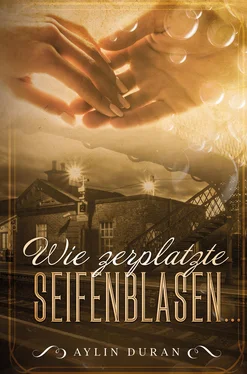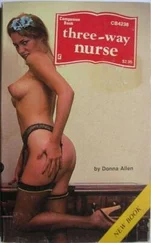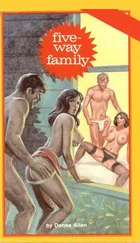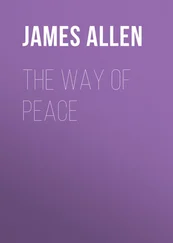„Was hörst du?“, fragte er, während seine schwieligen Hände bei dem Versuch, seine Finger warm zu halten, unaufhörlich die Saiten streichelten und Klänge erzeugten.
Ich hatte keine Ahnung von Musik, keinen eigenen Musikgeschmack. Ich hörte eben, was alle hörten. Das, was modern war und es in die Charts schaffte. Aber irgendwie wollte ich ihm das nicht sagen. Ich wollte nicht preisgeben, wie normal – wie wenig besonders und langweilig – ich war. Denn ich wusste sofort, dass Ben anders war. Und dass es mir gefiel. Aber ich fand nicht nur seinen Musikgeschmack interessant, ich interessierte mich dafür, wie er zu seinen Ansichten gekommen war, traute mich allerdings nicht, ihn danach zu fragen. Obwohl ich nicht alles, was er von sich gab, unterstützen oder verstehen konnte, mochte ich es, dass er eine eigene Meinung hatte.
„Grouplove?“, fragte er, während er einzelne Saiten langsam anschlug, um mir so die Möglichkeit zu geben, das Lied zu erkennen.
„Nie gehört.“
Außer den einzelnen Anfangstönen, die Ben gespielt hatte, hörte sich das Lied nicht traurig an. Die Akkorde flossen ineinander, es war ein schöner Song, schöner als Lithium, aber wahrscheinlich konnte ich das gar nicht beurteilen.
„Itching on a photograph“, gab Ben bekannt und öffnete die Augen einen winzigen Spalt. „Da ist eine Fotografie, aber sie ist alt und vergilbt, eigentlich ist die Zeit also längst vergangen. Die Person ist wehmütig, aber sie weiß, dass es Zeit ist … Zeit ist, loszulassen.“ Während er sprach, wurde seine Stimme immer leiser, bis ich ihn kaum mehr verstehen konnte. Sein Blick schweifte ab ins Nirgendwo und ich sah diese furchtbare Traurigkeit ganz deutlich in seinen Schokoaugen, eine Traurigkeit, die auf ihm lag, ihn niederdrückte und ihn plötzlich vollkommen erfasst zu haben schien. Wie ein Schatten.
„Es tut mir leid. Ich wollte nicht …“
Sein Blick wurde verschlossen. „Hast du auch nicht.“
Wir schwiegen uns an, bis die ersten zaghaften Sonnenstrahlen unsere durchgefrorenen Körper wärmten. Ben packte seine Sachen zusammen, während ich sitzen blieb und in die Sonne blinzelte.
„Wohin gehst du jetzt?“, fragte ich ihn zögernd.
Er stand mit dem Rücken zu mir, seine Locken standen in alle Richtungen ab, sein Pullover war zerknittert. Er antwortete, ohne sich zu mir umzudrehen: „Ein billiges Hotel suchen. Schlafen.“ Seine Stimme klang rau und erschöpft.
Gerne hätte ich auch einen Plan gehabt, was ich in dieser fremden Stadt jetzt tun sollte, aber ich hatte keinen blassen Schimmer. Hatte meinen Koffer gepackt, war in einen Zug gestiegen, aber all das war eine Kurzschlussreaktion gewesen. Weil ich wegmusste, Distanz schaffen musste zwischen mir und … nein. Ich wollte nicht an das denken, was ich gesehen hatte. Schließlich war ich gekommen, um zu vergessen.
„Kann ich mitkommen?“, hörte ich meine eigene Stimme wie aus weiter Ferne fragen.
Ben fuhr herum und schien mich zum ersten Mal wirklich zu sehen. Mich anzusehen. Auf seinem Gesicht machte sich ein verwirrter Ausdruck breit, dann öffnete er den Mund, schloss ihn jedoch wieder, ohne meine Frage beantwortet zu haben. Schnell schüttelte ich den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben.
„Stell’ dich nicht hilfloser dar, als du es bist“, schalt ich mich leise. Er war ein Fremder. Es reichte, dass ich mich die ganze Nacht mit ihm am Bahnhof herumgetrieben hatte. „Blöde Idee“, sagte ich. „Vergiss sie.“ Ich stand so hastig auf, dass ich stolperte. Ich spürte seine Blicke im Rücken, als ich begann, meine Taschen zusammenzusuchen. Ich vermied es, ihn anzusehen.
„Klar kannst du mitkommen“, hörte ich Ben sagen. „Ich meine … ich kann es dir nicht verbieten, die Bürgersteige zu benutzen, oder?“
Ich wusste, dass er grinste, obwohl ich ihm den Rücken zukehrte. „Bist du dir sicher?“, fragte ich, doch im selben Moment ärgerte ich mich bereits über die Unsicherheit in meiner Stimme und bereute es, gefragt zu haben.
Ben schulterte seine Gitarrentasche und seufzte. „Du kannst mitkommen oder hierbleiben. Es ist mir egal, was du machst, verstehst du?“
*
Mai
„Ich hätte gerne eine Pizza Peperoni.“ Durch das Fenster des Straßenverkaufsstandes starrte mich ein pubertierendes Mädchen an, dessen Gesicht ausschließlich aus Pickeln in verschiedenen Reifestadien zu bestehen schien. Ich starrte zurück und war beeindruckt von einem besonders großen, gelben Pickel, der sich direkt auf ihrer Nase befand. Es dauerte eine Weile, bis sie mir einen zerknitterten Fünfer entgegenstreckte und wiederholte: „Pizza Peperoni.“
Ich nahm den Geldschein entgegen und wollte ihn schon in das passende Fach der Kasse einsortieren, als mir auffiel, dass wir keine Pizza Peperoni verkauften. „Eh.“ Ich wollte ihr den Schein zurückgeben. „Peperoni gibt’s nicht.“
Allerdings machte das Mädchen keine Anstalten, das blöde Geld zurückzunehmen, ganz im Gegenteil: Trotzig hob sie ihr verpickeltes Kinn. „Warum nicht?“
„Keine Ahnung, vielleicht, weil Peperoni eklig ist?“, antwortete ich genervt. Eigentlich wollte ich sie nicht mehr anschauen, aber ihre Pickel hypnotisierten mich irgendwie.
Mit dem Zeigefinger tippte sie an die Außenfassade. „Da steht aber, dass Pizza Peperoni neu im Sortiment ist.“
Da fiel es mir wieder ein. Sie hatte recht – und das, obwohl sie eklig und hässlich war. Was sollte ich dazu sagen? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, schätzte ich. „Sorry, du hast recht.“
„Ich weiß, dass ich recht habe. Und weißt du was? Deinen Service fand ich ziemlich scheiße.“
„Wenn dir hier der Service nicht passt, warum bewegst du deinen Arsch dann nicht in ein schickes Restaurant und lässt dir dein Pickelgesicht da bedienen?“, giftete ich sie an.
Nach meiner letzten Aussage klappte ihr empört der Mund auf, es dauerte einen Moment, bis sie wieder fähig war, ihn zu schließen. Das freute mich. Ich mochte keine verwöhnten, reichen Mädchen, die grundsätzlich alles in den Arsch geschoben bekamen, ohne zu arbeiten.
„Weißt du nicht, wer ich bin?“ Sie machte einen weiteren Schritt auf mich zu und mittlerweile sah sie so wütend aus, dass ich froh war, dass ich für den Straßenverkauf arbeitete und mir niemand zu nah auf die Pelle rücken konnte, weil es ein Fenster zwischen mir und den Kunden gab.
„Klar weiß ich, wer du bist. Grace Kelly. Hab’ dich sofort erkannt.“
Sie stützte von außen die Ellenbogen auf die Verkaufsfläche und senkte ihre Stimme zu einem bedrohlichen Flüstern. Neben dem Geruch nach erkaltetem Fett roch ich nun den angenehmeren Geruch ihres Parfüms. „Weißt du überhaupt, für wen du arbeitest?“ Je näher sie mir kam, desto flächendeckender sahen die Pickel in ihrem Gesicht aus.
„Jetzt komm ich nicht mehr ganz mit, Quasimodo.“
„Mein Onkel schmeißt den Laden und bezahlt Vollidioten wie dich. Aber ich glaube nicht, dass du noch Geld von ihm kassieren kannst, wenn er erfährt, wie du deine Kunden behandelst.“ Mit diesen Worten und einem letzten empörten Schnauben kehrte sie mir den Rücken und rauschte davon.
Vor lauter Aufregung vergaß das Pickelgesicht sogar, dass sie die Pizza Peperoni schon bezahlt hatte.
*
Mai
Ich hatte so viel Zeit allein verbracht, dass es komisch war, Lina plötzlich bei mir zu haben. Lange, einsame Nächte mit keiner anderen Gesellschaft als meiner verbeulten Gitarre, frühe Morgenstunden mit kalten Füßen – wir Menschen sind stärker, als wir denken, wir können uns an alles gewöhnen, wenn wir den Zustand nur lang genug ertragen müssen. Wenn wir erkannt haben, dass es ohnehin kein Entkommen gibt. Auf dem schmalen Fußweg plapperte Lina vor sich hin, ich war mir sicher, dass es nur belangloses Zeug war, aber ich hätte ohnehin keine Kraft gehabt, ihr zuzuhören.
Читать дальше