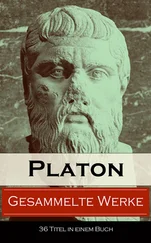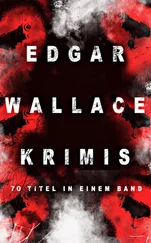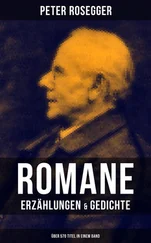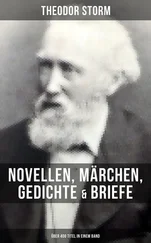»Fröhlich und glücklich«, murmelte Mr. Redlaw vor sich hin.
Das Zimmer fing an, seltsam dunkel zu werden.
»So sehen Sie, Sir«, sagte der alte Philipp, und seine gesunden alten Wangen nahmen einen rötern Schein an, seine blauen Augen einen hellern Glanz, »ich hab' 'ne Menge zu feiern, wenn ich dieses Fest feiere. Aber wo ist denn meine kleine, stille Maus? Schwatzen ist die Untugend meines Alters, und es ist noch die Hälfte der Zimmer zu schmücken, wenn wir bei der Kälte nicht vorher erfrieren, der Wind uns nicht wegbläst oder die Dunkelheit uns nicht verschlingt.«
Die kleine, stille Maus stand neben ihm mit ihrem ruhigen Gesicht und nahm schweigend seinen Arm, ehe er ausgesprochen hatte.
»Komm und laß uns gehen, mein Liebling«, sagte der alte Mann, »Mr. Redlaw kommt sonst nicht eher zum Essen, als bis es so kalt geworden ist wie der Winter draußen. Ich hoffe, Sie werden mir mein Geschwätz verzeihen, und ich wünsche Ihnen gute Nacht und nochmals eine fröhliche – –«
»Bleiben Sie«, sagte Mr. Redlaw und setzte sich wieder an den Tisch, mehr um den alten Kastellan zu beruhigen, wie es schien, als aus Appetit. »Noch einen Augenblick, Philipp. – William! Sie wollten eben noch etwas Ehrenvolles über Ihre treffliche Gattin sagen. Es wird ihr gewiß nicht unangenehm sein, ihr Lob aus Ihrem Munde zu hören. Was war es denn?«
»Ja, sehen Sie, Sir, das ist so eine Sache«, entgegnete Mr. William Swidger und sah seine Frau beklommen an. »Mrs. William sieht mich so an.«
»Fürchten Sie sich denn vor Mrs. Williams Blick?«
»Ach nein, Sir, ich sag's wie's ist –«, erwiderte Mr. Swidger. »Dazu ist ihr Blick nicht geschaffen, daß man sich davor fürchten sollte. Wäre das beabsichtigt gewesen, wäre er nicht so sanft ausgefallen. Aber ich möchte nicht gern – – – – Milly! Der – – –, weißt du! Der da unten im Hause –«
Mit großer Befangenheit in dem Geschirr herumkramend, warf Mr. William aufmunternde Blicke hinter dem Tisch hervor auf Mrs. William, beredt mit Kopf und Daumen auf Mr. Redlaw deutend, als wolle er sie aufmuntern.
»Der da unten, mein Herz«, fuhr er fort, »unten im Hause. So sag's doch, Kind. Du bist doch im Vergleich zu mir wie Shakespeares Werke. Der unten im Hause, du weißt doch, mein Kind – na, der Student.«
»Ein Student?« Mr. Redlaw hob den Kopf.
»Ich sag's wie's ist, Sir«, rief Mr. William eifrig beistimmend. »Wenn's nicht der arme Student unten im Hause wäre, warum sollten Sie es denn aus Mrs. Williams Munde zu hören wünschen?«
»Mrs. William, mein Kind – so sprich doch.«
»Ich wußte nicht«, sagte Milly mit einer ruhigen Offenheit und frei von jeder Unruhe oder Verwirrtheit, »daß William etwas davon verraten hat, sonst wäre ich nicht gekommen. Ich hatte ihn gebeten, es nicht zu tun. Er ist ein kranker junger Herr, Sir, und sehr arm, fürchte ich. Zu krank, um zum Feste nach Haus zu fahren. Er ist ganz verlassen und wohnt in einem Zimmer, das für einen vornehmen Herrn ziemlich ärmlich ist, unten im Jerusalemstift. Das ist alles, Sir.«
»Warum hab' ich nie von ihm gehört?« fragte der Chemiker und erhob sich rasch. »Warum hat man mich nicht von seiner Lage unterrichtet? Krank! Geben Sie mir meinen Hut und meinen Mantel. Arm? Wo wohnt er? Welche Hausnummer?«
»Sir, Sie dürfen nicht hingehen«, sagte Milly, ließ ihren Schwiegervater los und trat dem Gelehrten mit entschlossenem Gesicht und gefalteten Händen in den Weg.
»Nicht hingehen?«
»Um Gottes willen nicht«, sagte Milly und schüttelte den Kopf wie über eine selbstverständliche Unmöglichkeit. »Daran ist gar nicht zu denken.«
»Was meinen Sie? Warum denn nicht?«
»Ja, sehen Sie, Sir«, sagte Mr. Swidger eindringlich und wichtig »ich sag's auch immer. Verlassen Sie sich darauf, der junge Herr hätte nie einer Mannsperson seine Lage anvertraut. Mrs. William hat sein Vertrauen gewonnen, aber das ist auch etwas ganz anderes. Mrs. William vertrauen sie alle. Zu ihr haben sie alle das größte Zutrauen. Ein Mann, Sir, würde keinen Laut aus ihm herausgebracht haben. Aber eine Frau, Sir, und noch dazu Mrs. William –!«
»Es liegt viel Wahres und Zartes in dem, was Sie sagen, William«, gab Mr. Redlaw zur Antwort und betrachtete das sanfte und stille Gesicht neben sich. Und den Finger auf den Mund legend, reichte er ihr heimlich seine Börse.
»O Gott, ja nicht, Sir«, rief Milly und gab sie wieder zurück. »Das wäre noch viel schlimmer. Daran ist nicht im Traum zu denken.«
So gelassen und ruhevoll war ihr Temperament, daß sie nicht einen Augenblick aus dem Gleichgewicht kam und bereits im nächsten Augenblick in ihrer Hausfrauenart schon wieder ein paar Blätter auflas, die beim Anstecken der Stechpalme zwischen Schere und Schürze durchgeschlüpft waren.
Als sie wieder aufsah und bemerkte, daß Mr. Redlaw sie noch immer zweifelnd und erstaunt betrachtete, wiederholte sie ruhig, während sie umhersah, ob nicht vielleicht doch noch etwas ihrer Aufmerksamkeit entgangen sei: »O Gott nein, ja nicht, Sir, er sagte, von allen Menschen auf Erden dürften Sie am allerwenigsten seine unglückliche Lage erfahren, und er wolle um alles gerade von Ihnen keinen Beistand haben, obwohl er Student in Ihrer Klasse sei. Ich habe Ihnen zwar nicht das Wort abgenommen, daß dies alles ein Geheimnis bleiben solle, aber ich verlasse mich auf Ihre Ehrenhaftigkeit, Sir.«
»Warum hat er das gesagt?«
»Das kann ich wirklich nicht wissen, Sir«, gestand Milly, nachdem sie eine Weile nachgedacht, »dazu bin ich nicht scharfsinnig genug, wissen Sie. Ich wollte mich ihm auch bloß nützlich machen und alles um ihn reinlich und hübsch halten und alles ein bißchen behaglicher einrichten und habe das bis jetzt getan. Aber eines weiß ich, daß er arm und verlassen ist und daß sich niemand um ihn kümmert – Wie finster es nur ist!«
Das Zimmer wurde dunkler und dunkler. Es war, als ob ein trüber Schatten sich hinter dem Stuhl des Chemikers bilde.
»Was wissen Sie weiter von ihm?« fragte er.
»Er ist verlobt und will heiraten, sobald er die Mittel dazu hat«, sagte Milly, »und studiert, glaube ich, um sich später eine Lebensstellung schaffen zu können. Ich sehe schon lange zu, wie viel er sich versagt und wie angestrengt er studiert. Wie dunkel es nur ist!«
»Es ist auch kälter geworden«, sagte der alte Mann und rieb sich die Hände. »Es ist so schaurig und unheimlich hier drinnen. Wo ist mein Sohn William? William, mein Sohn, schraube die Lampe auf und schüre das Feuer!«
Millys Stimme ertönte wieder wie sanfte leise Musik: »Er sprach gestern aus unruhigem Schlummer, nachdem er meinen Namen genannt (das sagte sie zu sich selbst), etwas von einem Verstorbenen und von einem großen Unrecht, das niemals gesühnt werden könne; ob das aber ihm oder jemand anderem widerfahren ist, das weiß ich nicht. Er hat es nicht getan, das weiß ich.«
»Kurz, Mrs. William, – – sehen Sie, – sie würde es nicht eingestehen, Mr. Redlaw, und wenn sie das ganze nächste Jahr bleiben müßte –«, flüsterte William dem Chemiker ins Ohr, »hat ihm unendlich viel Gutes getan. Wirklich unendlich viel Gutes. Dabei merkt man zu Hause nichts – mein Vater hat es immer noch so behaglich und bequem wie früher, kein Stäubchen ist in der Wohnung zu sehen und zu finden, und wenn Sie es mit fünfzig Pfund aufwiegen wollten. Immer ist Mrs. William da, wenn sie gebraucht wird, treppauf, treppab; – sie ist wie eine wirkliche Mutter zu ihm.«
Immer dunkler und schauriger wurde das Zimmer, und der dunkle Schatten hinter dem Stuhle wurde immer dichter und schwerer.
»Und nicht genug damit, Sir, geht Mrs. William heute abend aus und findet auf dem Heimweg – noch ist es nicht ein paar Stunden her – ein Geschöpf, das eher einem wilden Tier als einem Kinde gleicht, frierend auf einer Türschwelle sitzend und vor Kälte zitternd. Was tut Mrs. William? Sie nimmt es nach Hause, gibt ihm zu essen und behält es bei sich, bis morgen am Weihnachtstag die übliche Spende an Essen und Flanell verteilt wird. Wer weiß, ob das Geschöpf je Wärme gefühlt hat? Jetzt sitzt es an dem alten Kamin und starrt das Feuer an, als wolle es die gierigen Augen nie wieder zumachen. Es muß wenigstens noch dort sitzen«, sagte Mr. William, »wenn es nicht ausgerissen ist!«
Читать дальше