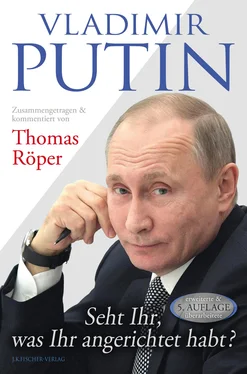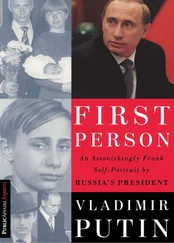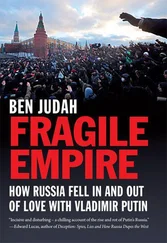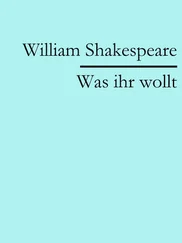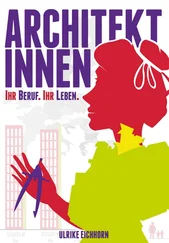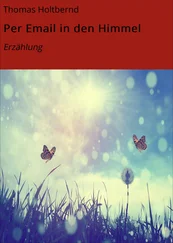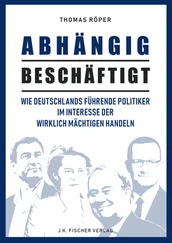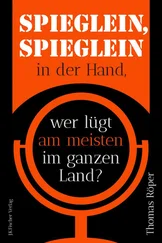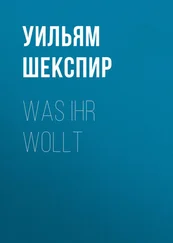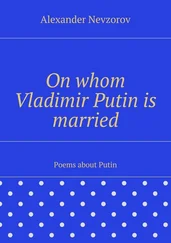Da Russland immer noch pleite war, fehlte auch Geld für dringend nötige Investitionen in die Öl- und Gasförderung. Westliche Ölkonzerne waren gerne bereit, zu „helfen“. Dazu wurden sogenannte PSA-Verträge (Production Sharing Agreement) geschlossen. Bei solchen Verträgen verspricht der Investor Investitionen, bekommt aber dafür einen Großteil des geförderten Öles. Und zwar so lange, bis seine Investitionen eingespielt sind. Das wiederum kann man problemlos manipulieren, indem man die Investitionen und Kosten künstlich aufbläht. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, die einfachste – aber bei weitem nicht einzige – ist es, mit der Mutterfirma einen Beratervertrag zu schließen und auf diese Weise völlig überhöhte Beraterhonorare, die man sich de facto selbst zahlt, in die Kosten einzurechnen. Auf diese Weise erhöht man den eigenen Gewinn zu Hause und die Kosten im Lande des PSA-Abkommens. Also muss man dem Staat, mit dem man das PSA-Abkommen geschlossen hat, nur einen Bruchteil des geförderten Öls oder Gases abgegeben.
Im Falle Russlands führten diese Verträge dazu, dass Russland kaum mehr als 20 Prozent seines geförderten Öls und Gases selbst verbrauchen oder verkaufen konnte, der Rest ging direkt an westlichen Ölkonzerne wie Shell. Damit hatte der ohnehin bankrotte Staat ohne Not auf einen Großteil seiner Staatseinnahmen verzichtet und die Schulden wuchsen weiter.
Im Westen wurde Jelzin als der Hüter der russischen Demokratie dargestellt, während die Berichte über Russland wahlweise von unendlich reichen Mafiosi oder unsäglicher Armut und obdachlosen Kindern handelten.
So war das Bild Russlands im Westen in den 1990er Jahren geprägt von dem Bedauern für die armen Menschen, dem Unverständnis für den Reichtum von Oligarchen und Mafiosi, während Russland gleichzeitig als Demokratie dargestellt wurde, obwohl es eine reine Oligarchie war, in der die Oligarchen ihren Einfluss auf die Politik ausbauten. Und am Ende der 1990er Jahre war das Land fest in den Händen der Oligarchen.
Die 1990er sind denn auch bis heute im Gedächtnis der Russen die schwärzeste Zeit der jüngeren Geschichte.
Im August 1998 kam es zur Staatspleite in Russland, der Staat konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen und die Währung brach komplett zusammen. Das ist etwas, was man tatsächlich erlebt haben muss, um es zu verstehen. Zunächst gab es fast eine Woche lang schlicht keine Wechselkurse, weil niemand wusste, was der Rubel nun wert war. Die Geschäfte räumten ihre Regale leer, weil sie nicht wussten, zu welchem Preis sie verkaufte Waren nachkaufen können, also konnten sie auch keine Preise für die vorhandenen Waren nennen. Ich bin damals einen ganzen Tag lag durch die Millionenstadt St. Petersburg gefahren, um ein paar Rollen Toilettenpapier zu suchen.
Nach etwa einer Woche gab es endlich wieder Wechselkurse und die Waren kehrten in die Regale zurück. Allerdings war der Rubel, der vorher 3 Rubel für eine D-Mark gekostet hatte, nun bei 15 Rubel für eine D-Mark, und somit waren die meisten Preise nun um das Fünffaches gestiegen. Man kann sich kaum vorstellen, was es bedeutet, wenn fast alles über Nacht fünfmal soviel kostet wie vorher. Und das in einem mittlerweile bettelarmen Land, in dem die Menschen ihre ohnehin minimalen Löhne oft mit Monaten Verspätung ausgezahlt bekamen.
Dazu machte damals ein Witz die Runde in Russland: Fragt ein Direktor den anderen: „Kommen Deine Arbeiter auch immer noch zur Arbeit, obwohl Du ihnen keinen Lohn auszahlst?“
„Ja“
„Vielleicht sollten wir in Zukunft am Fabriktor Eintritt nehmen?“
Ein weiteres Problem damals war, dass es seit 1994 in dem zu Russland gehörenden Gebiet Tschetschenien einen blutigen Krieg gab. Zwischen 1994 und 1996 wurde dort gekämpft, und am Ende bekam das Gebiet eine Autonomie, die de facto eine Unabhängigkeit war. In dem Gebiet wurde die von Saudi-Arabien geprägte wahhabitische Auslegung des Islam inklusive Scharia eingeführt.
Zu diesem Krieg gibt es zwei Sichtweisen. Die westliche Sichtweise spricht von dem Unabhängigkeitskampf des tschetschenischen Volkes, die russische Sichtweise ist eine andere: Es waren keineswegs die Tschetschenen, die für ihre Unabhängigkeit kämpften, sondern eingesickerte arabische Salafisten, die dort – Zitat der Rebellen damals – „einen islamischen Staat, ein Kalifat“ errichten wollten. Diese Begriffe, die im Westen erst ab 2012 bekannt wurden, als arabische wahhabitische Islamisten im Irak und in Syrien ihr Terrorregime errichteten, waren in Russland bereits seit 1994 ein Thema.
Das Ziel der Islamisten war es, den gesamten Kaukasus, also das russische, aber islamisch geprägte Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, unter Kontrolle zu bekommen.
Nachdem es ab 1996 über zwei Jahre lang relativ ruhig war, begann im August 1999 ein Angriff der Islamisten auf die islamisch bewohnte und zu Russland gehörende Teilrepublik Dagestan. Nun stand die Bevölkerung auf, und noch bevor die desolate russische Armee eingreifen konnte, kämpften die Dagestaner gegen die angreifenden Islamisten. Dies war der Beginn des zweiten Tschetschenien-Krieges, an dessen Ende der Sieg Russlands und die Wiedereingliederung Tschetscheniens in den russischen Staat stehen sollte.
In diesem Krieg wurden ohne Zweifel Kriegsverbrechen begangen, und es geht in diesem Buch nicht um Tschetschenien und darum, ob man der westlichen Sichtweise folgt oder der russischen. Es geht darum, zu verstehen, wie der Standpunkt des Anderen ist. Und zum Verständnis ist es wichtig, dass man beide Sichtweisen kennt. Nur wer auch die Sichtweise des Anderen kennt, ist in der Lage, ihn zu verstehen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Ich wiederhole es: Man muss dieser Sichtweise nicht zustimmen, aber man sollte sie zumindest kennen, um für sich selbst entscheiden zu können, welcher man sich anschließt.
Wer nur eine Sichtweise kennt, kann diese Entscheidung nicht treffen, sie wurde für ihn bereits von anderen getroffen.
1999 ging es den Russen schlecht, und die Stimmung im Land war mies. Die Bevölkerung war verarmt, der Staat pleite, und ein Krieg im Süden des Landes drohte das ganze Land zu destabilisieren.
Die Zentralregierung verlor immer mehr an Macht und ganze Regionen weigerten sich, ihren Anteil am Staatsbudget nach Moskau zu überweisen. Das wäre so, als wenn sich Niedersachsen weigern würde, Steuereinnahmen an den Bund zu überweisen, die aber dem Bund nach geltendem Gesetz zustehen.
Das geflügelte Wort lautete „Moskau ist weit“ und das Land stand vor dem Auseinanderbrechen, denn neben der Weigerung ganzer Regionen, sich an Gesetze zu halten und ihren Anteil zum Staatshaushalt beizutragen, gab es auch Ideen für die Bildung eigener Staaten wie der „Republik Ural“ und anderen.
Jelzin wechselte in dieser Situation die Premierminister ständig aus – von August 1998 bis Ende 1999 hatte Russland fünf Premierminister. Ein Land, das nun eigentlich einen Plan zur entschlossenen Bekämpfung der verschiedenen Krisen brauchte, war politisch lahmgelegt.
Aber im Jahr 2000 standen Präsidentschaftswahlen an und die Oligarchen begannen, darüber nachzudenken, wie sie einen Wahlsieg der Kommunisten verhindern und Jelzin, der gemäß Verfassung und auch wegen seiner Gesundheit nicht mehr antreten konnte, durch einen neuen Präsidenten ersetzen konnten, der ihnen auch weiterhin treu ergeben war.
Einer der führenden Oligarchen dieser Zeit war Boris Beresowski, der darüber hinaus Chef der Präsidialverwaltung und damit quasi die graue Eminenz Russlands war. In Russland war die Politik unter Jelzin komplett von den Oligarchen beherrscht. Später erklärte Beresowski in Interviews, dass er es war, der Putin als neue Marionette der Oligarchen auserkoren hatte. Und er fügte hinzu, dass er dachte, mit Putin „gleiche Werte“ zu teilen und es in der Folge bereut habe, Putin gefördert zu haben. Denn Putin hatte sich nach seiner Wahl zum Präsidenten in den Kopf gesetzt, die Macht der Oligarchen zu brechen. Dazu später mehr.
Читать дальше