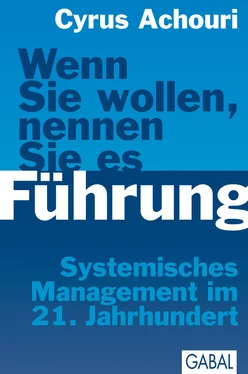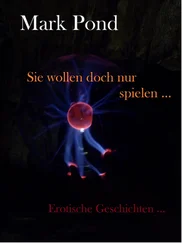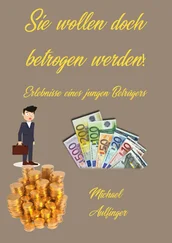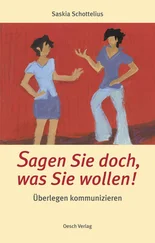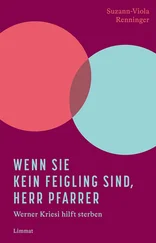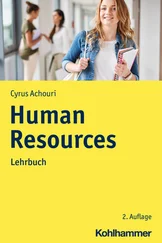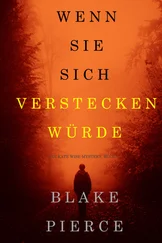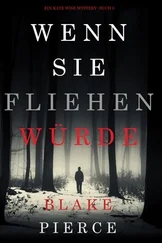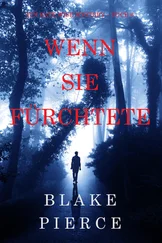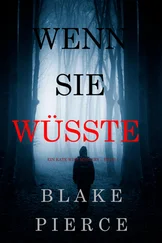Während es bei Nullsummenspielen äußerst wirksam ist, seinen Gegner strategisch zu verunsichern, ist es im Gefangenendilemma wie im richtigen Leben gerade wichtig, dem anderen die eigenen Intentionen deutlich zu machen; Raffinesse zahlt sich also nicht aus. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, den anderen zur Kooperation zu ermutigen. Dabei lässt sich die Absicht zur Kooperation durch beidseitige Taten praktisch demonstrieren. Axelrod spricht sich ausdrücklich dagegen aus, Vertrauen bei den Akteuren vorauszusetzen. Gegenseitigkeit reicht aus, um Defektion unproduktiv zu machen. Ebenso ist auch Altruismus unnötig, da auch Egoisten kooperativen Strategien in ihrer Nützlichkeit folgen.
Kooperation braucht keine Überwachungsinstanz
Axelrod kommt zum Ergebnis, dass sich gegenseitige Kooperation selbst überwacht und demnach in ihrer Selbstorganisation keine zentrale Herrschafts- oder Überwachungsinstanz benötigt. Zwar sind Axelrods spieltheoretische Ergebnisse immer wieder auch dafür genutzt worden, den Vorteil der Defektion herauszustreichen. Dabei wird aber unterschlagen, dass Defektion nur dann eine erfolgreiche Strategie ist, wenn sie auf den unmittelbaren Vorteil aus ist. Wenn die Akteure sich nicht wiederholt treffen, ist die Strategie der Defektion durchaus erfolgreich. Mittel- und langfristig stellt sich ein Akteur jedoch besser, wenn er mit seinem Gegenüber ein Muster wechselseitiger Kooperation installiert. Angewandt auf evolutionäre makroskopische Zeiträume bis hin zu Spannen, die mehrfache, wiederholte Interaktionen im Mikrobereich betreffen, im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens beispielsweise, ist Kooperation also die dominante Strategie, solange sie nicht einseitig propagiert wird. Eine reine Kooperationsstrategie ohne »Provokationsfähigkeit« würde ebenso scheitern wie eine reine Defektionsstrategie.
Auch für Extremsituationen nennt Axelrod Beispiele erfolgreicher Kooperationen. Demnach zeigt sich kooperatives Verhalten sogar bei verfeindeten Kriegsparteien. Im Sinne einer »Leben-und-leben-lassen-Strategie« entwickelten sich etwa im Ersten Weltkrieg Kooperationen zwischen Feinden, sogar gegen den Widerstand des oberen Kommandos. Freundschaft ist demnach keine Bedingung für Kooperation, sie zeugt vielmehr von der Dauerhaftigkeit einer Beziehung.
Kooperation: sogar ohne Gehirn möglich
Die Theorie der Kooperation kann auch Verhaltensmuster im biologischen Bereich erklären, von Vögeln bis zu Bakterien oder Viren. Die Existenz eines Gehirns ist dabei keine Voraussetzung. Kooperation kann sich in biologischen Systemen selbst dann entwickeln, wenn die Beteiligten nicht miteinander in Beziehung stehen, und auch dann, wenn sie unfähig sind, die Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens zu erkennen. Ein Organismus, der eine günstige Antwort bei einem anderen erreicht, wird sich und sein Verhaltensmuster mit größerer Wahrscheinlichkeit fortpflanzen und damit in der biologischen Welt Kooperation, die sich auf Gegenseitigkeit gründet, stabilisieren. (Axelrod 2009) Kurzfristige Vorteile werden in der Evolution zugunsten mittel- und langfristiger Vorteile hintangestellt.
Bei Lebensgemeinschaften von Fischen unterschiedlicher Arten kommt es beispielsweise vor, dass ein kleiner Fisch Parasiten vom Körper sowie aus dem Inneren des Mauls größerer Fische entfernt, und dies selbst bei Raubfischen, die seine potenziellen Feinde sind. Langfristig profitieren beide davon unter Erhaltung der egoistischen Vorteile. Der Raubfisch wird von Parasiten befreit, der kleine Fisch erhält Nahrung. Der Raubfisch untergräbt seinen kurzfristigen Nutzen, den kleinen Fisch zu fressen, dadurch erhält er aber den langfristigen Vorteil der Parasitenbeseitigung. Überdies hätte er durch die Dezimierung der hilfreichen Kleinfische eine starke Zunahme der Parasiten zu beklagen. Umgekehrt hätten die Kleinfische unter Umständen Vorteile, wenn sie nicht nur auf die Parasiten abzielten, sondern versuchten, sich auch direkt vom Raubfisch zu ernähren. Langfristig würde dies aber zum Abbruch der Kooperation führen und beide Seiten hätten damit einen Nachteil. (Gräfrath 1997)
Kooperation – eine langfristige und wechselseitige Strategie
Kooperation kann durch eine kleine Gruppe in Gang gebracht werden, die auf die Erwiderung von Kooperation eingestellt ist, auch wenn sonst niemand auf der Welt kooperiert. Kooperation muss auf Gegenseitigkeit beruhen und langfristig gedacht sein, um stabil zu werden. Evolutionär stabil bleibt eine Strategie dann, wenn eine Population von Individuen, die diese Strategie verwendet, einer Invasion durch einen einzelnen Mutanten mit einer abweichenden Strategie widerstehen kann. Wenn Kooperation in einer Population einmal etabliert ist, kann sie sich gegen die Invasion von unkooperativen Strategien schützen. Es zeigt sich außerdem, dass es nie rational ist, als Erster unfreundliche Akte zu begehen. Die erfolgreiche Strategie lautet also: Kooperiere im ersten Zug, und tue ab dem zweiten Zug genau das, was dein Gegenüber im vorherigen Zug getan hat. Man könnte also humanisierend sagen, Tit for Tat sei »nett«, »provozierbar« und »vergebend«. (Gräfrath 1997, 31)
Dabei darf nicht übersehen werden, dass Tit for Tat immer nur auf lange Sicht erfolgreich ist, da die Strategie von der Kooperationsbereitschaft aller anderen Mitspieler abhängt. Wenn alle anderen Mitspieler Kooperation stets ablehnen, wird Tit for Tat im ersten Spielzug am schlechtesten abschneiden. Auf lange Sicht zeigt sich aber, dass diejenigen Programme, welche die schwächeren »ausbeuten«, nach und nach ihre eigene Erfolgsgrundlage zerstören, da die Kooperateure nach und nach aussterben. Tit for Tat kann, einmal etabliert, auch nicht von Nicht-Kooperateuren erobert werden, da die schnelle Provozierbarkeit das Programm davor bewahrt. Für erfolgreiche »Verhandlungen« im Sinne der Spieltheorie sind also wiederholte Kontakte notwendig, ein minimales Gedächtnis sowie die Fähigkeit, bisherige Verhandlungspartner zu identifizieren. (Gräfrath 1997)
Rat: Keinen Ärger beginnen
Axelrod fasst die Verhaltensmaximen, die sich aus den Interaktionssimulationen ergeben, so zusammen: »Wenn Sie von anderen erwarten, dass sie Ihre Defektion ebenso wie Ihre Kooperation erwidern, dann sind Sie gut beraten, keinen Ärger zu beginnen. Darüber hinaus sind Sie gut beraten zu defektieren, nachdem jemand anderes defektiert hat, um zu zeigen, dass Sie sich nicht ausbeuten lassen. Folglich sollten Sie eine Strategie verwenden, die auf Gegenseitigkeit beruht. Da dies auch für jeden anderen zutrifft, bekommt die Wertschätzung von Gegenseitigkeit einen selbsttragenden Charakter. Sobald sie in Gang kommt, wird sie stärker und stärker.« (Axelrod 2009, 170)
Teleologie spielt heute kaum eine Rolle
In der Evolutionsbiologie ist man heutzutage zu einem großen Teil von teleologischen Aussagen abgekommen, also von der Annahme, es gäbe einen Plan, einen Zweck oder eine zielgerichtete Entwicklung des Lebens. (Dawkins 2005; Capra 1996) Charles Darwin (1859) hingegen ging noch von einer Stufenleiter aus, wonach die späteren Formen bessere Formen seien, welche die alten im Daseinskampf besiegt hätten.
Obwohl Richard Dawkins ein teleologisches Verständnis von Evolution ablehnt, spricht er dennoch von einer »Evolution der Evolutionsfähigkeit« und nimmt auf der Ebene der Makroevolution eine Entwicklung an: im Sinne eines fortschreitenden Trends zu einer immer besseren Evolutionsfähigkeit. Diese beinhaltet eine verbesserte Überlebens- wie auch Fortpflanzungsfähigkeit. Susan Blackmore teilt Dawkins moderate Evolutionsteleologie, indem sie zwar ein konkretes Ziel der Evolution sowie einen definierten Schöpfer verneint, aber durchaus in der Zunahme der Komplexität einen Fortschritt sieht: »Die Evolution benutzt ihre eigenen Produkte als Trittleiter.« (Blackmore 2005, 41)
Читать дальше