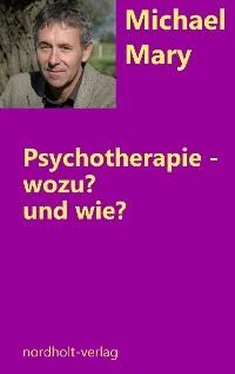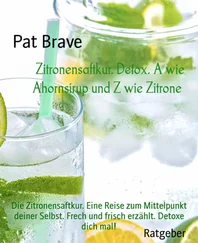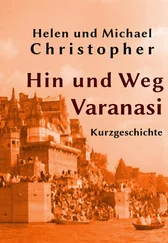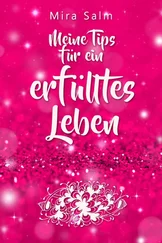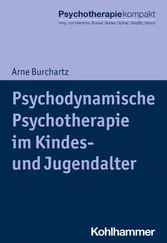Halten wir also fest: Psychotherapeuten kommen zum Einsatz, wenn nichts medizinisch Greifbares gefunden wird und die Mittel der Ärzte versagen. Das Beispiel zeigt auch, wann Psychotherapie nicht angebracht ist. Nämlich dann, wenn eine medizinische Ursache für einen Leidenszustand feststeht.
Nun wird der Unterschied zwischen Medizin auf der einen und einem Psychotherapie auf der anderen Seite nachvollziehbar. Handelt es sich um einen Zustand, dem eine klare Ursache zugeordnet werden kann und für den eine eindeutige Diagnose zur Verfügung steht, dann kommen Ärzte (und Psychiater) als Behandler zum Einsatz. Handelt es sich um einen unklaren Zustand, für den man auf die Vermutung psychischer Gründe angewiesen ist, dann kommen Psychotherapeuten als Begleiter zum Einsatz.
Der Unterschied zwischen Medizin und Psychotherapie ist demnach der Unterschied zwischen einer Behandlung und einer Begleitung.
Um diesen Unterschied noch weiter zu verdeutlichen, hier ein weiteres kurzes Beispiel.
Ein 38jähriger Mann kommt in geistig verwirrtem Zustand in ein Krankenhaus und redet wirres Zeug. Wohin mit ihm? Auf die Intensivstation oder in die Psychiatrie? Entweder erfährt der Arzt, dass sein Patient gerade Drogen genommen hat, dann weist er ihn nicht in die Psychiatrie ein, sondern behandelt ihn medizinisch. Oder der Arzt erfährt, dass der Betroffene gerade Zeuge einer Gewalttat war, dann wird er ihn für traumatisiert halten und ihn einer psychotherapeutischen Betreuung zuführen.
Beide Beispiele weisen auf den wesentliche Unterschied zwischen Medizinern (und Psychiatern) auf der einen und Psychotherapeuten auf der anderen Seite hin. Dieser Unterschied besteht in den Dingen, mit denen sich die jeweiligen Spezialisten befassen. Die einen wenden sich den greifbaren Dingen zu, die anderen befassen sich mit den nicht greifbaren Dingen. Die einen befassen sich mit dem Körper, die anderen mit der Psyche.
Umgang mit vagen Vorgängen
Der Körper ist im Vergleich zur Psyche konkret und greifbar, die Psyche ist im Vergleich zum Körper vage und unbestimmt. Der Körper ist bei jedem Menschen relativ gleich aufgebaut. Deshalb kann und sollte beispielsweise Diabetes strukturiert behandelt werden. Der Arzt, der Diabetes behandelt, geht am besten nach einem festgelegten Plan vor. Zuerst stellt er fest, ob es sich um eine Typ A- oder Typ B-Diabetes handelt. Er misst den Blutzucker. Er empfiehlt gegebenenfalls einen Ernährungsplan. Er spritzt Insulin. Er führt anschließend Kontrolltests durch. Dem Mediziner ist es dabei gleichgültig, unter welchen Umständen sein Patient aufgewachsen ist, ob es ihm an Selbstbewusstsein mangelt, welchen Beruf er ausübt und ob er eine Liebesbeziehung hat oder nicht. Er braucht den Menschen nicht zu kennen, nicht einmal seinen Namen, er reicht ihm, sich mit dessen Körperteilen zu befassen.
Wer sich allerdings mit der Psyche befasst, der kann nicht auf vorgegebene Schemata und Ordnungsprinzipien zugreifen. Die Psyche der Individuen ist unterschiedlich strukturiert. Die Erfahrungen, die Erwartungen und die Weltsicht des Einzelnen sind im wahrsten Sinn des Wortes einzigartig. Deshalb kann eine Psyche nicht nach Plan A oder Plan B behandelt werden, vielmehr muss der Psychotherapeut auf die individuellen Besonderheiten seines Klienten eingehen. Dabei kommt es auf schwer greifbare Faktoren an, auf unübersichtliche Lagen, auf die konkreten Lebensumstände, auf das Beziehungsgeflecht, auf die Einstellungen des Betroffenen. Wie waren seine Eltern? Hat er Geschwister? Gibt es unverarbeitete Schicksalsereignisse? Wodurch wurde seine Krise ausgelöst? Über welche psychischen Ressourcen verfügt er? Welcher Sinn mag in der Störung liegen? Was wird er als Lösung seines Problems empfinden?
Psychotherapie tut etwas, das weder Medizin noch Psychiatrie tun können. Sie befasst sich mit den nicht verallgemeinerbaren Dingen: mit der Individualität eines Menschen, mit seinen psychischen Besonderheiten, mit jenen Merkmalen und Merkwürdigkeiten, die aus ihm erst ein Individuum machen.
Der Soziologe Peter Fuchs hat das Phänomen der Psychotherapie einer Analyse unterzogen 1und dabei nach einer Antwort auf die systemisch-soziologische Frage gesucht, mit der er gesellschaftliche Phänomene aufschlüsselt. Diese Frage lautet: „Als Lösung welchen sozialen Problems lässt sich die Psychotherapie deuten?“ 2Die Antwort auf diese höchst aufschlussreiche Frage lautet: Psychotherapie löst das gesellschaftliche Problem, mit individualisierten Psychen umzugehen. Psychotherapie deckt den zunehmenden Bedarf an Fachleuten, die mit Themen und Sachverhalten umgehen können, die in kein vorgegebenes Schema passen und für die es keine vorgegebenen Lösungen gibt. Peter Fuchs bezeichnet Psychotherapeuten daher treffend als moderne „Verwalter der vagen Dinge“, einen Begriff, den er vom Philosophen Paul Valéry ausgeliehen hat.
Besser kann man es meines Erachtens kaum ausdrücken. Die Psyche ist kein fassbares Ding. Niemand hat je eine Psyche gesehen. Selbst wenn man das Gehirn eines Menschen in Scheiben schneidet oder in Moleküle zerlegt, wird man darin keine Psyche finden. Unter dem Mikroskop tauchen nur Zellen, Stoffwechselvorgänge und Synapsen auf, weder Gedanken noch Gefühle. Die Psyche verarbeitet keine chemischen Stoffe, so wie das Gehirn, die Nieren oder die Leber es tun. Sie pumpt kein Blut durch die Adern wie das Herz es tut und löst keinen Sauerstoff aus der Luft, um ihn dem Blut zuzuführen, wie die Lunge das macht.
Die Psyche hat nur eine einzige Aufgabe: Sie deutet Wahrnehmungen und versucht ihnen Sinn zu verleihen.
Die Psyche deutet Hirnereignisse und sie deutet von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Daher können verschiedene Menschen zwar das Selbe sehen, aber dennoch etwas ganz Unterschiedliches erleben. Ihnen kann dasselbe Ereignis zustoßen, aber sie verarbeiten es zu ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Sie können den gleichen Umständen ausgesetzt sein und entwickeln dennoch völlig unterschiedliche Reaktionen darauf. Sie können die gleichen Erlebnisse gehabt haben, und diese dennoch ganz unterschiedlich erinnern.
Die geschilderte Erkenntnis dessen, was Psychotherapeuten tun, lässt Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Entwicklung der jüngeren Geschichte zu. Denn da es die Psychotherapie erst seit etwa 130 Jahren in einer modernen Form gibt und da ihre Bedeutung weiter zunimmt, muss in der neuen Zeit der Bedarf an individuellen Lösungen psychischer Probleme enorm zugenommen haben. Dass dies tatsächlich der Fall ist, zeigt ein Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zur Entstehung der Psychotherapie geführt haben.
1Siehe hierzu das Video Peter Fuchs über Psychotherapie
2Siehe hierzu von Peter Fuchs Die Verwaltung der vagen Dinge , 2011 Carl-Auer-Systeme Verlag Heidelberg, Seite 28
Der Bedarf an Psychotherapie nimmt stetig zu
Wie gesagt, da sich die Psychotherapie in der heutigen Form erst seit kurzer Zeit gibt und ihr Auftrag in der Begleitung von Einzelnen liegt, muss es zu einem enormen Zuwachs an Individualität gekommen sein. Ein Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung zeigt, dass dies tatsächlich der Fall ist und klärt, warum der Bedarf an individueller Orientierung in wechselnden Lebensumständen weiter zunimmt.
Gruppenidentität - wer man früher war
In den Jahrhunderten vor dem 19. Jahrhundert unterschied sich die Lebenswelt des Einzelnen völlig von der heutigen. Die Menschen lebten in einer ständisch strukturierten Gesellschaft. Deren übersichtliche Struktur vermittelte eine verlässliche Orientierung. Wie man sich in dem jeweiligen Stand zu verhalten hatte, was man denken, sagen und fühlen sollte, was man tun oder lassen durfte, wozu man verpflichtet war und was einem blühte, wenn man sich nicht an die Regeln hielt, all das war unzweifelhaft und jedem bekannt. Der Einzelne verfügte daher über ein einziges, relativ klar definiertes Ich, er wusste, wer er war . Er war entweder Leibeigener, Bauern, Handwerker, Bürger oder Feudaler – andere ‚Seinsmöglichkeiten’ standen nicht zur Verfügung.
Читать дальше