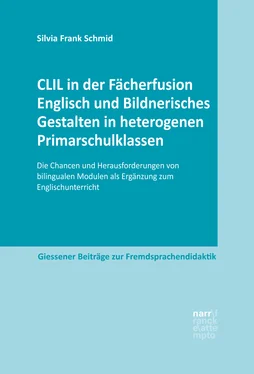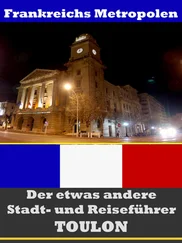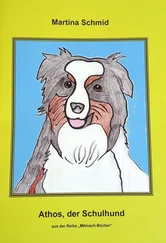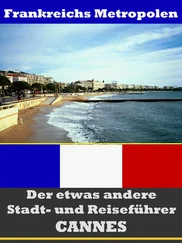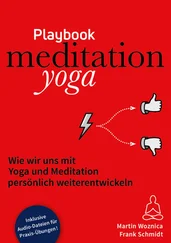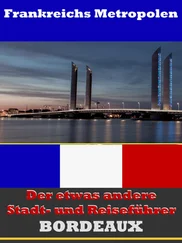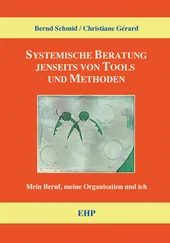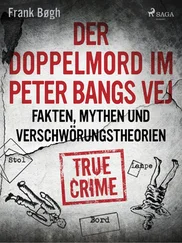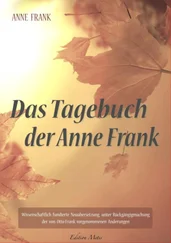1 ...7 8 9 11 12 13 ...29
2.5.3 Handlungsorientierung
Neben der Anschaulichkeit bietet der BG-Unterricht auch eine hohe Handlungsorientierung. Diese wird nicht nur als besonders lernfördernd für den Unterricht mit Kindern allgemein angesehen, sondern gilt ganz besonders bedeutsam für den CLIL-Unterricht (Massler & Ioannou-Georgiou 2010, S. 69). Der Tastsinn wird oft als «Ursprung aller Empfindungen» betrachtet, mit welchem die Kinder die Dinge er -greifen und so die Welt be -greifen (Gall 2016, S. 136). Allgemein ist bekannt, dass ein Grossteil der Schülerschaft der Gruppe der praktisch-anschaulichen Lerntypen zugehört (Klippert 2010, S. 54). Diese Erkenntnisse haben bereits renommiere Reformpädagogen wie Montessori oder Freinet erkannt und konsequent in ihre Pädagogik integriert (Gehring 2017, S. 19). Dass der Fachbereich BG eine besondere Affinität zur Handlungsorientierung hat, muss nicht weiter begründet werden. Doch auch der moderne Fremdsprachenunterricht orientiert sich einer handlungsorientierten Didaktik, die über den kommunikativen Ansatz hinaus die Anwendung der gelernten Sprache aktiv und selbstgesteuert im Hier und Jetzt beim Bewältigen von Lernaufgaben fordert (Chesini & Klee 2017, S. 1; Eisenmann 2019, S. 68; Europarat 2001, S. 22). Handlungsorientierung und Lernaufgaben gehen somit miteinander einher. Diese sind in einer reichen Lernumgebung verankert und lassen sich daher optimal im kontextreichen CLIL-Unterricht verwirklichen (Rüschoff 2015, S. 353). Dies bewahrheitet sich ganz speziell für den bilingualen BG-Unterricht, wo der Anspruch nach diesen grundlegenden Bedürfnissen des haptischen, handlungsorientierten und aktiven CLIL-Lernens besonders gut nachgekommen werden kann und dessen positiven Auswirkungen auf den dualen Kompetenzaufbau vielfach belegt sind (vgl. Bechler 2014; Witzigmann 2011; Rymarczyk 2003). Abschliessend an dieser Stelle ein Zitat von Vygotsky, der lange vor der Verbreitung des Begriffs ‘Handlungsorientierung’ die symbiotische Beziehung von Sprache und Handlung erkannte: « Children solve practical tasks with the help of their speech, as well with their eyes and hands .» (Vygotsky 1978, S. 35).
2.5.4 Visual literacy und Bildkompetenz
Bilder sind im BG naturgemäss ein genuiner Bestandteil des Unterrichts. Der Begriff ‘Bilder’ umspannt jegliche zweidimensionale bewegte oder unbewegte Abbildungen im Zusammenhang mit Kunst oder aus dem Alltag, Videos oder andere Animationen; sowie dreidimensionale Werke aus der Architektur, Plastik oder Performance und schliesslich auch Abläufe oder Erinnerungsbilder (D-EDK 2014 BG, Didaktische Hinweise; Schoppe 2015, S. 8). Auch im Fremdsprachenunterricht werden Bilder seit geraumer Zeit als Gesprächsanlass oder zur Veranschaulichung zum Beispiel durch Lehrwerke in den Unterricht eingespeist und erfüllen dabei unterschiedliche illustrative, semantische, repräsentative, instruktive oder bildästhetische Funktionen (Hallet 2015, S. 33–38). In beiden Fächer BG und Englisch ermöglichen Bilder somit nicht nur das sachfachliche und sprachliche Lernen, sondern fördern in den letzten Jahren auch vermehrt die Auseinandersetzung mit bildlichen Materialien als solches. Die Förderung dieser ‘visuellen Kompetenz’ im Zeitalter der bildbasierten Technologien ist ein zentrales Anliegen, das über den BG-Unterricht hinaus in verschiedenen Fächern adressiert werden muss (Rymarczyk 2015, S. 184; Schoppe 2015, S. 26). « It has become vital that 21st century students, as learners and global citizens, transcend from passive receivers of visual messages in media to active deconstructionist of visual grammar given the exploding technological advances in multimedia .» (Lundy & Stephens 2015, S. 1058)
Im anglosächsischen Raum ist der Begriff ‘ visual literacy’ verbreitet. Obschon dafür verschiedene Definitionen vorliegen, wird heute damit hauptsächlich die Kompetenz gemeint, visuelle Botschaften zu lesen, zu interpretieren und zu verfassen. « Visual literacy can be defined as a set of abilities that enables an individual to effectively find, interpret, evaluate, use, and create images and visual media .» (Lundy & Stephens 2015, S. 1058) Visual literacy umschliesst somit rezeptive als auch produktive Komponenten im Umgang mit Bildern (Schröder 2015, S. 24–25; Hecke & Surkamp 2010, S. 15). Als Synonym wird im deutschen Sprachraum dafür der Begriff ‘Bildkompetenz’ verwendet und meint ebenfalls, dass sich Lernende nicht nur auf der rezeptiven und produktiven Ebene mit Bildern befassen, sondern auch über diese reflektieren und darüber kommunizieren. «Unter Bildkompetenz sind Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Haltungen zu verstehen, die es Schülerinnen und Schüler ermöglichen, sich in einer von Bildern geprägten Umwelt zu orientieren.» (D-EDK 2014 BG, Didaktische Hinweise)
In der Fusion von BG und Englisch funktioniert die Förderung von Bildkompetenz oder visual literacy optimal: Einerseits braucht es Bilder in Form von Visualisierungen, um Inhalte in der Fremdsprache zu vermitteln. Gleichzeitig schaffen Bilder Anreize sie zu beschreiben oder zu kommentieren (Grundy, Bociek & Parker 2011, S. 10). Sprache evoziert visuelle kognitive Effekte, Bilder ebenso verbale. Kognitionswissenschaftler gehen davon aus, dass diese reellen und verbalen Bilder im gleichen Gehirnareal angelegt sind und sich somit wirkmächtig beeinflussen (Seidl 2007, S. 2–3). Jeder Mensch reagiert – bewusst oder unbewusst – konstant auf visuelle Eindrücke. In dem Sinne sind alle visual literate . Die wahre Kunst liegt nun darin, dieses enorme Potential an Eindrücken und Urteile über Bilder in Sprache – für den CLIL-Unterricht in Fremdsprache – umzuwandeln (Seidl 2007, S. 7). Leisen (2005, S. 10) spricht in diesem Zusammenhang auch vom Wechsel der Darstellungsformen, der den Lernenden erlaubt die Inhalte in unterschiedliche Abstraktionsebenen zu transferieren. Die verschiedenen Ebenen – von gegenständlichen Handlungen, über bildliche Darstellungen, hin zur sprachlichen Verarbeitung – werden im BG genuin integriert. Damit Versprachlichung dieser visuellen Eindrücke im CLIL-Unterricht gelingen kann, müssen die Schüler*innen mit dem methodischen Vorgehen bei Bildbeschreibungen vertraut gemacht und mit entsprechendem Scaffolding begleitet werden (vgl. IDEA-Methode im Kapitel 3.6.1) (O. Meyer 2010a, S. 14).
2.5.5 Natürliches Lernsetting mit hohem Lebensweltbezug
Neben der eigentlichen kreativen Arbeit benötigen die Lernenden im BG ausreichend rezeptive und produktive Sprachkompetenzen. Zum Beispiel müssen Lernende Arbeitsanweisungen verstehen; Materialien, Verfahren, Werkzeuge oder weitere Hilfsmittel benennen; Werke beschreiben sowie Eindrücke und Erfahrungen schildern. Viele dieser Redemittel in Form von Wörtern oder chunks (z. B. scissors, brush, pens, colours and shapes, prepositions aber auch Strukturen wie: There is / are…, I can see.., etc. ), werden im frühen Englischunterricht eingeführt. Beim Integrieren dieser sprachlichen Mittel in den BG-Unterricht gewinnen sie an grosser Bedeutung, da sie in authentischen Situationen angewendet werden (Heim 2013, S. 65). Die Lernenden erleben den bilingualen BG-Unterricht als ein authentisches Lernsetting, in dem lebensnaher Wortschatz und alltägliche Strukturen verwendet werden können. Dies gilt insbesondere für einen ‘ English as foreign language’ Lernkontext, wie die Schweiz, wo die Lernenden der Fremdsprache ausserhalb der Schule nur unregelmässig begegnen: « When there are no ‘streets’ around the school in which the language could be picked up, one may try to convert school life, or parts of it, into a naturalistic environment (…)» (Dalton-Puffer 2007, S. 2). Der CLIL-Unterricht mit BG, im Gegensatz zu abstrakteren oder mehr textbasierten Fächern, schafft eine optimale Basis für diesen Anspruch an eine natürliche, fremdsprachliche Lernumgebung.
Читать дальше