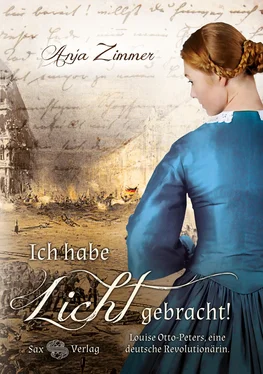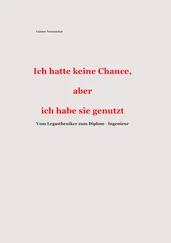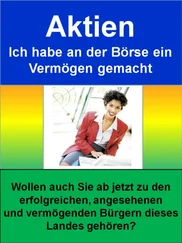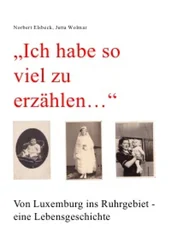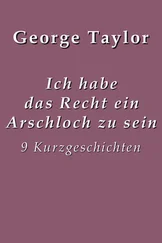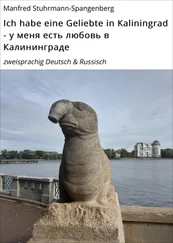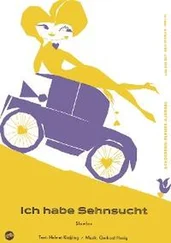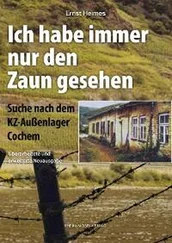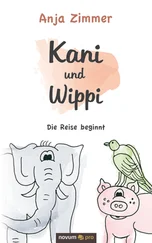Ein geeintes Deutschland mit einer freiheitlichen, ja sogar demokratischen Verfassung wurde gefordert.
Aber die Männer, die dieses Leuchtfeuer deutschen Volkswillens entzündet hatten, waren nicht in der Lage, es am Brennen zu halten. Die Fackel verlosch in einem Sumpf aus Eitelkeit, Eigensinn und Kleinkrämerei. Bei der abschließenden Versammlung, bei der sich die führenden Köpfe der Opposition heißredeten, wurde lediglich beschlossen, das jeder auf eigene Faust handeln solle. Man war sich einig, dass man sich nicht einigen konnte. Die Behörden hielten sich nicht lange damit auf, sich darüber zu amüsieren, sondern handelten. Alle Forderungen, die man so kühn in den Hambacher Sommer gerufen hatte, kamen als ein hohnlachendes Echo zurück: Die Repressalien wurden verstärkt, Oppositionelle umso gnadenloser verfolgt, die Zensurschrauben noch enger angezogen. Denn natürlich sah die Obrigkeit in diesem Fest keinen Aufbruch in eine strahlende Zukunft, sondern den Untergang jeglicher Ordnung. Anarchie und Bürgerkrieg würde ihrer Meinung nach dieser Hambacher Skandal nach sich ziehen.
Tatsächlich berichtete die Presse in den umliegenden Kleinstaaten ausführlich über das Hambacher Fest, was die Menschen in den angrenzenden Gebieten zu Aufständen ermutigte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit mussten herrschen, wollte man der Obrigkeit die fatalen Missstände aufzeigen. Wie sonst sollte Abhilfe geschaffen werden, wenn man immer nur über den Hunger und das Elend der Menschen schwieg? Doch die Hoffnungen auf Freiheit und ein besseres Leben gingen unter im Kugelhagel der Soldaten.
Heinrich Heine, der selbstverständlich auch auf der schwarzen Liste stand, die von den Behörden geführt wurde, schrieb nur wenig später:
»Während den Tagen des Hambacher Festes hätte mit einiger Aussicht guten Erfolges die allgemeine Umwälzung in Deutschland versucht werden können. Jene Hambacher Tage waren der letzte Termin, den die Göttin der Freiheit uns gewährte.«
Aber die Menschen ließen nicht locker: Am 3. April 1833 stürmten die Frankfurter die Konstablerwache, in der Hoffnung, dadurch eine Revolution in allen Ländern des Deutschen Bundes auszulösen, doch auch sie scheiterten. Allerdings machten sie mit ihrer Aktion den Herrschenden nur allzu bewusst, wie brandgefährlich die Stimmung unter den Menschen war. Um die Friedhofsruhe weiter zu gewährleisten, versammelte Fürst Metternich seine Mitstreiter 1834 in Wien zu einer Ministerialkonferenz, bei der ganz im Geheimen alle Zugeständnisse, die man bisher gewährt haben mochte, wieder rückgängig gemacht wurden: Die Abgeordneten in den örtlichen Parlamenten, die ohnehin kaum gegen ihre Provinzfürsten ankamen, wurden weiter in ihren Rechten beschnitten, durften nicht einmal mehr beim Haushalt mitbestimmen, sondern nur noch zuschauen, wie ihre Fürsten immer mehr Geld für Prunk und Militär ausgaben, anstatt dem hungernden Volk die Steuerlast zu erleichtern. Das Militär sollte nur noch auf den Monarchen vereidigt werden, nicht einmal mehr auf eine Verfassung – und sei sie noch so rückständig. Und natürlich wurden Meinungs- und Pressefreiheit noch weiter eingeschränkt.
Überall waren Spitzel unterwegs. Die Polizei überwachte jeden, der auch nur im Verdacht stand, eigenständig zu denken, und auch diejenigen, die laut auszusprechen wagten, dass man die Arbeiter mit ihren Familien nicht verhungern lassen könne. Dass man den Kindern, die sich schon mit fünf Jahren ihre Knochen in den Fabriken kaputtschufteten, doch wenigstens abends ein wenig Schulunterricht gönnen solle. Dass man die Kinder nicht zwölf Stunden am Tag und an sechs Tagen in der Woche für Löhne arbeiten lassen sollte, die nicht ausreichten, um sie satt zu machen. Dass man den Webern faire Preise zahlen, den Klöpplerinnen im Erzgebirge wenigstens so viel geben sollte, dass sie sich und ihre Kinder vor dem Hungertod bewahren könnten.
Wer dies aussprach, wurde hart verfolgt und bestraft. Doch die Lage in den deutschen Ländern wurde für die Ärmsten der Armen immer prekärer. In den Fabriken standen moderne Maschinen, die in Windeseile schafften, wofür ein Mensch an seiner Werkbank Tage brauchte. Für diese Menschen war der Fortschritt geradezu tödlich. Konnte, durfte das sein, dass der Fortschritt über die Menschen hinwegschritt; sie niederwalzte und zermalmte? War unter diesen Umständen Fortschritt möglich? Musste der technische Fortschritt nicht zwangsläufig einhergehen mit einem neuen Menschenbild, einer neuen Gesellschaftsordnung? Konnte es auf lange Sicht gut gehen, wenn nur ein Teil des Volkes im 19. Jahrhundert angekommen war und der weitaus größere Teil noch lebte wie im Mittelalter? Würde sich die tödliche Seite dieser Entwicklung nicht irgendwann bitterst rächen, zerstörerisch wüten in den Villen und Palästen derer, die im Moment davon profitierten? Konnte man wollen, dass Arbeiter ausschließlich arbeiteten? Sechzehn Stunden am Tag? Ohne Absicherung bei Krankheiten, die bei der schweren Arbeit, die in vielen Fabriken verrichtet wurde, gang und gäbe waren? Konnte man zulassen, dass der Fortschritt abrupt zum Stehen kam vor der ärmlichen Behausung derer, die ihn mit ihrer Hände Arbeit schufen?

Unterdessen war der Tod erneut im Hause Otto eingekehrt. Nach Clementines Tod hatte sich Louise enger an die Mutter angeschlossen, doch eines Tages begann die Mutter, immer heftiger zu husten. Der Husten wurde immer stärker und schüttelte unbarmherzig ihren Leib, der zusehends schwächer wurde. Die Auszehrung oder Schwindsucht war nicht heilbar. Louise war sechzehn Jahre alt, als die Mutter im Oktober 1835 starb. Charlotte war erst 54 Jahre alt.
Der Vater versuchte nun, seinen Töchtern alles zu sein, Vater und Mutter. Vor allem um seine Jüngste machte er sich Sorgen, weil die größte Sorge der Mutter auf ihrem Sterbebett Louise gegolten hatte. Was sollte aus dem verträumten, verwachsenen Mädchen werden, dessen Augen bald intensiv in die Welt schauten, bald sich nach innen zu wenden schienen, wo sie das Gesehene kaum verarbeiten konnten? Louise war dankbar für ihren verständnisvollen Vater, der sie mit allem, was sie tat, gewähren ließ. Er redete ihr nicht drein, wenn sie las, schrieb oder einfach nur still vor sich hin blickte. Enger als jemals schloss sie sich an ihren Vateran, in dem sie einen Vertrauten und einen Verbündeten in ihrer Trauer fand. Doch im Februar 1836 starb er an einem Schlaganfall.
Louise hatte das Gefühl, in eine bodenlose Dunkelheit zu fallen.

Dresden im Frühjahr 1839
Es war ein schöner Frühlingsabend, als Louise und ihre Schwestern mit dem Schiff nach Dresden fuhren. Antonie und Francisca wurden begleitet von ihren Bräutigamen, die sie Tante Therese vorstellen wollten. Nach allen Erzählungen waren die beiden jungen Herren nicht erpicht darauf, aber irgendwann musste es sein.
Das Schiff passierte die letzte Flussbiegung und vor ihnen lag im Schein der Abendsonne die barocke Stadt mit ihren Türmen, der dunklen Kuppel der Frauenkirche. In der Nähe des Schlosses streckte eine Baustelle ihre Kräne in den Himmel.
Immer näher kamen sie, deutlicher hoben sich die Bauten aus dem Abenddunst hervor, bald sahen sie die Anlegestelle, an der schon viele Menschen auf das Schiff warteten.
»Antonie, siehst du schon unsere Tante Therese?«, fragte Louise und beugte sich an der Reling vor.
»Wie könnte ich Tante Therese übersehen? Schau, da drüben steht sie und schwenkt ihren Regenschirm, wahrscheinlich aus lauter Angst, wir könnten sie übersehen, uns in Dresden verlaufen und unter die Räder kommen.«
Читать дальше