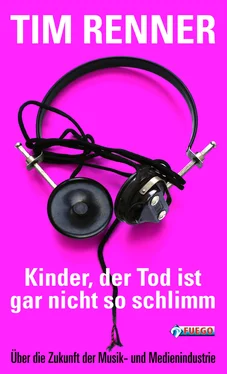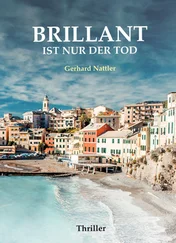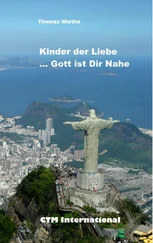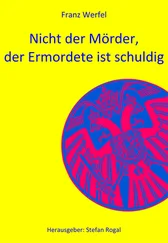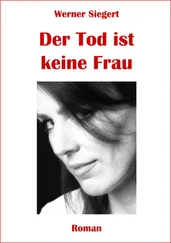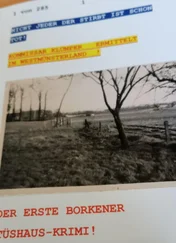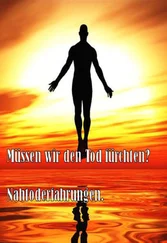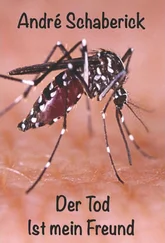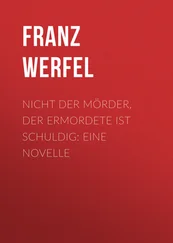Zu Anfang pilgerten fast alle Verantwortlichen der Sender zu Ad Roland, um von ihm zu lernen, wie das geht. Der in die Jahre gekommene DJ aus Holland war einer der wenigen, der sich schon lange mit den Modalitäten des Privatfunks auskannte. Noch unter dem Monopol des Staatsfunks hatten die so genannten Seesender von internationalen Hoheitsgewässern aus in Richtung England und Benelux ihre Programme ausgestrahlt. Ad Roland war mit Radio Mi Amigo dabei, so lange bis der Frachter Magdalene, der als Basis diente, 1979 strandete und von den niederländischen Behörden aufgebracht wurde. Als Radio-Consultant ging es ihm aber deutlich besser als auf hoher See. Er brachte privaten und auch öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern bei, wie man die Musikarchive drastisch zusammenstreicht (teilweise auf bis zu 500 Titeln, also 5 Prozent dessen, was auf einen gewöhnlichen Apple iPod passt), um das Format des Senders klar herauszuarbeiten, wie man mit Jingles umgeht, damit der Claim des Senders einem jeden geläufig und die Station bei der nächsten Media Analyse bekannt genug ist, damit der Befragte meint, sie gehört zu haben. Er brachte den Moderatoren die ewig gute Laune bei und schulte sie darin, ein Tonstudio komplett selbstständig zu bedienen.
Letzteres war sicher ein Segen. Ich musste dereinst noch dem Tontechniker ein Zeichen geben, »abwinken«, bevor der nächste Titel kam. Beim letzten Satz hieß es: Arm hoch. Wenn einem dann doch noch etwas einfiel, saß man blöd hinter der Scheibe, mit ausgestrecktem Arm, der sich erst senken durfte, wenn das letzte Wort gesprochen war.
Derselbe Lehrer, dieselbe Zielgruppe, identische Erhebungstechniken – aus der medialen Vielfalt wurde in der Breite Einfalt. Die meisten Sender klangen einfach gleich und tun das bis heute. Der Radioberater und die Auswirkungen seiner Ratschläge auf das Programm war nicht allein ein deutsches Phänomen. In Amerika dankten es die Rapper von Public Enemy dieser Berufsgruppe 1992 mit dem Song How To Kill a Radio Consultant.
Das Paradies – Gefilmt von Peter Rüchel und Andreas Thiesmeyer
In den sechziger Jahren begann der lange Marsch des Fernsehens ins Herz der deutschen Familie. Während 1954 noch mickrige 88278 Fernseher angemeldet waren, gab es 1964 bereits 10 Millionen Geräte. Anfang der siebziger Jahre war das Fernsehen praktisch in jedem deutschen Haushalt präsent. Es hatte stillschweigend das Radio als Zentrum des Familienverbandes ersetzt – aus dem Prinzip Volksempfänger war das elektronische Lagerfeuer geworden. Die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten teilten sich den Kuchen auf: hier die föderal strukturierte ARD mit ihren unterschiedlich mächtigen Regionalsendern, dort das ZDF als zentralisierter Riesenapparat. Popmusik tröpfelte ganz langsam ins Programm. Einzelne streitbare Redakteure in den jeweiligen Funkhäusern erkämpften sich die Flächen.
»Nun ist es endlich so weit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im Deutschen Fernsehen, die nur für Euch gemacht ist. Und Sie, meine Damen und Herren, die Sie Beatmusik nicht so mögen, bitten wir um Ihr Verständnis.« Mit diesen Worten kündigte der spätere Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben den ersten Beat Club am 25. September 1965 an. Michael »Mike« Leckebusch hieß der ambitionierte Unterhaltungsredakteur bei Radio Bremen, der das neue Format bei den Senderverantwortlichen durchgesetzt hatte; Uschi Nerke war seine Moderatorin. Anfangs tastete man sich mit lokalen Stars wie den Rattles oder den Lords ans Publikum heran, später kamen dann Bands wie Steppenwolf, Jethro Tull oder Status Quo, aber auch die Beach Boys, The Doors oder Kraftwerk dazu. Die Auftritte waren selbstverständlich live, eine Hand voll überdrehter Studiogäste feierte jede Band. Die Jugendlichen waren begeistert, die Eltern empört, die Medien ratlos. Zum ersten Mal öffnete sich das deutsche Fernsehen für die musikalischen Innovatoren aus den USA und aus England.
Schnell sprach sich das TV-Ereignis herum und wurde für jeden halbwegs angesagten Jugendlichen unverzichtbar. Da es noch keinen eigenen Fernseher im Kinderzimmer gab, kam es am Samstagnachmittag in zahllosen Familien zum Generationenkonflikt. Die Eltern schimpften auf »Negermusik« und »langhaarige Gammler«, deren Darbietungen keinen schlechten Einfluss auf den Sohn oder die Tochter ausüben sollten. Die Kinder moderierten, übersetzten, erklärten – ständig darum bemüht, keine Sekunde der kostbaren Sendung zu verpassen. Von Empörung und Ablehnung bis zu Annäherung und gemeinsamer Begeisterung: Popmusik und Fernsehen waren die Grundlage eines großen Identitätsdiskurses im Wohnzimmer.
Bis 1972 produzierte Leckebusch 86 Sendungen vom Beat Club. »Zum Schluss hatte ich nur noch die Kiffer vor der Röhre«, klagte er, und tauschte das Auslaufmodell gegen ein neues Format aus – den Musikladen. Psychedelische Farbspielereien, poppige Überblendungen, Go-Go-Tänzerinnen ohne Hemd, aber noch mit Höschen, und kreischende Bildverfremdungen waren Zeichen einer neuen Zeit. Das bewährte Team wurde ab 1973 mit dem präpotenten Co-Moderator Manfred Sexauer aufgefrischt. Und wieder prägte Leckebusch die deutsche Pop-Geschichte: Ein Auftritt in seiner Sendung galt unter Künstlern und Plattenfirmen als Garant für den Einstieg in die Charts. Leckebusch war das Nadelöhr, sein Geschmack entschied, bei ihm standen die Promoter Schlange. Um einen Auftritt im Musikladen und im Nachfolger Musikladen Eurotops wurde mit allen Mitteln gekämpft. Leckebusch hatte beim Sender irgendwann durchgesetzt, dass die Sendung ohne störendes Publikum produziert werden konnte, und kurzerhand das Studio zu sich nach Hause verlegt. Etwas schaurig war die Anreise schon, denn sein Anwesen lag mitten im Wald, nah der Autobahn nach Bremerhaven. Im Stil typischer »Ich-hab-es-geschafft«-Architektur der siebziger Jahre wirkte es wie ein reichlich aufgepumptes Reihenhaus. Das Studio befand sich im Anbau – auf 50 Quadratmetern. Hierhin reisten also die Pop-Legenden, drängelten sich zwischen Kabeln und Kameras auf die Bühne und erfreuten sich an der clubartigen Atmosphäre und den ebenso freundlichen wie hübschen Praktikantinnen. Newcomer, von denen Leckebusch noch nicht völlig überzeugt war, konnten sich bei ihm für 10.000 Mark einen Blue-Screen-Auftritt für spätere Promotionzwecke erkaufen. Der wurde dann mit für den Musikladen typischen Psychedelic-Effekten hinterlegt. So entwickelte Leckebusch die frühe deutsche Variante des Musikvideos.
Ohne ihn lief gar nichts, er war Regisseur, Produzent und Redakteur in einer Person. In den siebziger Jahren galt er als mächtigster Mann der Branche. Und er nutzte diese Macht für höchst individuelle Entscheidungen – spielte Tina Turner, als niemand sonst das tat, boxte Roxy Music in die Charts und brachte Boney M. unglaubliche 15-mal, bis auch der letzte Zuschauer Rivers of Babylon mitsingen konnte. 1984 endete der Musikladen nach 90 Ausgaben mit Do They Know It’s Christmas Time.
Andere Musikformate waren dazugekommen und hatten Leckebuschs Sendung das Monopol streitig gemacht – die WDR Plattenküche mit Helga Feddersen und Frank Zander, Bananas und Känguruh mit Hape Kerkeling. Hier war Erfinder und Redakteur Rolf Spinnrads höchst individuell um die Musik bemüht. Was ihm gefiel, bekam volle Unterstützung. Und sei es die völlig unbekannte Deutschrockband Düsenberg, die so oft in seiner Plattenküche angekündigt wurde, ohne dort zu erscheinen, dass ihr allein der Auftritt in der letzten Folge den ersten und einzigen Hit einbrachte. Es gab Disco mit Ilja Richter und dem damals schon entscheidungsstarken, aber nicht immer geschmackssicheren Redakteur und späteren Musikmanager Thomas Stein. Es gab die Music Box im Kabel mit den Redakteuren Jörg Hoppe und Christoph Post, die später als Mitgründer von VIVA das deutsche Musikfernsehen erheblich prägen sollten.
Das Musikvideo wurde im deutschen Fernsehen von Formel Eins entdeckt. Andreas Thiesmeyer, ehemaliger Polydor-Außendienstmitarbeiter und späterer Produktmanager von James Last und der Kelly Family, überzeugte die ARD-Sendeverantwortlichen, ihm für das ungewöhnliche Konzept in den dritten Programmen eine Versuchsfläche einzuräumen. Internationale Künstler hatten 1983, als Formel Eins im April zu senden begann, in der Regel ein Video; bei lokalen Künstlern war es die absolute Ausnahme. Thiesmeyer löste das Problem, indem er einfach selbst Videos produzierte. Über seinen Geschmack mag man streiten, aber alle deutschen Bands, die in die Charts wollten, standen irgendwann auf dem Bavariagelände zwischen Oldtimer-Wracks und brennenden Mülltonnen vor den Kameras seines Teams. Ein unglaublicher Aufwand wurde betrieben. Mehr noch als zuvor im Musikladen konnte ein Auftritt in Formel Eins über die Karriere eines Künstlers entscheiden. Thiesmeyer war sich dessen bewusst, stellte sich zusammen mit Redakteur Roman Colm manch scharfer Diskussion mit Künstlern und Plattenfirmen. Der Erfolg wurde ab Januar 1988 mit einem Sendeplatz im ersten Programm am Samstag um 15 Uhr belohnt. Vorher lief Formel Eins am Abend. Mit der neuen Uhrzeit entfernte sich das Format von der Musik und seiner eigentlichen Zielgruppe – um 15 Uhr schauten Kinder oder Rentner zu, aber immer weniger Fans. Mit Reisereportagen versuchte man vergeblich, den Verfall der Sendung zu stoppen. Ab 1990 übernahm konsequenterweise der Disney Club.
Читать дальше