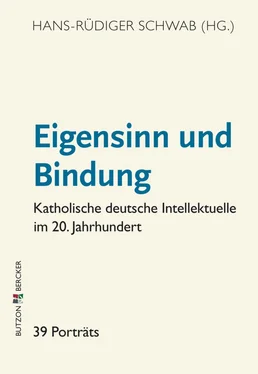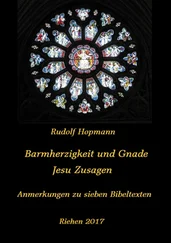Die Bekanntschaft mit Gertrud von le Fort hat auch bei Edith Stein tiefe Spuren hinterlassen. Ein Jahr vor ihrem Eintritt ins Kloster schlug sie Sr. Callista Kopf vor, im Deutschunterricht unter anderem Werke von le Fort durchzunehmen: den historisch-legendenhaften Roman „Der Papst aus dem Ghetto“ und den in der Gegenwart spielenden Erziehungsroman „Das Schweißtuch der Veronika“. 10Die wohl größte geistige Gemeinsamkeit zwischen beiden Frauen bestand in der Tatsache, dass sie Richtschnur und Auftrag für ihre Arbeit aus der Bibel empfangen haben. Wilhelm Grenzmann hebt bei Gertrud von le Fort die drei Motivkreise Kirche, Reich (das sacrum imperium des Mittelalters) und Frau hervor. 11Diese sind auch Edith Stein sehr wichtig gewesen. Die Motivkreise sind bei Gertrud von le Fort nicht als chronologische Abfolge zu sehen, sondern bilden eine ineinander verschlungene Thematik, welche die Dichterin ihr Leben lang begleitete.
Ihre Werke artikulieren einige wesentliche Aspekte des weiblichen Erfahrungsbereiches und geben eine klare Vorstellung dessen, was sie damit anstrebte. Das von ihr gezeichnete „neue“ Frauenbild war tatsächlich nicht radikal neu. Es ist eher als eine Neuakzentuierung zu interpretieren gegenüber dem Frauenbild der Moderne im Allgemeinen und dem Bild der „Neuen Frau“ der Weimarer Republik im Besonderen. Das Leben in den 1920er-Jahren wurde von dem Modell der Frau beherrscht, die ihre Selbstständigkeit anstrebte, das Recht auf freie Sexualität proklamierte und sich durch wissenschaftlichen Ehrgeiz auszeichnete. 12Auch wenn Gertrud von le Fort gewisse Veränderungen befürwortete, blieben ihre Auffassungen zum Wesen und zur Rolle der Frau dennoch traditionell geprägt. Die Situation zwischen Mann und Frau war bei ihr eine grundlegend andere als bei den modernen und gern gelesenen Autorinnen der Weimarer Republik. Nicht die einseitige Sehnsucht nach Emanzipation, sondern nach der Anerkennung der Gleichwertigkeit bestimmt hier das Verhältnis der Geschlechter. Sie beabsichtigte mit ihren Werken keine moralische Revolution. Sie betonte andere Kräfte, wie etwa die Liebesfähigkeit, und stellte diese in ihrem Frauenbild heraus. Diese im Vergleich zu dem Frauenbild der 1920er-Jahre auf den ersten Blick „regressive“ Festlegung der Frau auf ihre gefühlsmäßige und „liebende“ Natur schließt Fragen nach dem Wesen und Wert der Frau nicht aus. Ganz im Gegenteil: Die le Fortsche Suche nach einer wahren Menschlichkeit der Frau brachte im Endeffekt deren Darstellung als vollwertiges Wesen, dem mit seiner Kraft zur Verzeihung und zur Gewaltlosigkeit gleichsam eine Erlöserrolle zugeschrieben wird. Ihre Protagonistinnen sind meist starke Gestalten, die mit viel Energie ihre Selbstverwirklichung anstreben. Sie können jedoch trotz ihrer Fähigkeit, progressive und traditionelle Aspekte im Leben zu integrieren, nicht als „Superfrauen“ bezeichnet werden. Ganz gewiss jedoch kritisieren sie das Konzept einer aggressiven, „einseitigen und übersteigerten Männlichkeit“.
Respektierung unterschiedlicher Glaubensformen
Durch ein intensives Leben in und mit der Kirche sowie eindringliche Beschäftigung mit der christlichen Thematik gelangte Gertrud von le Fort in ihrem zwischen 1945 und 1968 entstandenen Spätwerk zu einer neuen Tiefenschau. Sie fasste Dichtung nun nicht nur als eine Art moralischen Engagements auf, wie dies insbesondere in der mittleren Schaffensperiode der Fall war, sondern grundlegend als metaphysische Betrachtung der Seins- und Gottesfrage bezüglich der Aktualität von Glaube und Religion. Dem veränderten Selbstverständnis der Nachkriegsgeneration entsprechend, entwickelte sie jenen theologisch-religiösen Personalismus weiter, der sich von Anfang an wie ein roter Faden durch ihr Gesamtwerk zieht. Ihre literarischen Arbeiten bejahen das Lebens in all seinen irdischen und geistigen Formen.
Mit ihnen trat sie hervor als eine traditionsgebundene Repräsentantin der Moderne des 20. Jahrhunderts und dessen existenzieller und transzendentaler Sinnsuche im Zeitalter einer sich rasant entwickelnden Technologie. Die konfessionellen Aspekte verloren mit der Zeit an Bedeutung. Viel deutlicher ist in dieser Phase die Betonung der Liebe Christi und seiner Gnade für alle, welche in ihrem Leben nach Wahrheit suchen. Mit anderen Worten: Von Christus aus fällt Licht in Fülle auf alle Lebensbereiche und alle Menschen, wobei die Wirksamkeit dieser Ausstrahlung von deren Aufnahmebereitschaft abhängig ist. Dies ist unter anderem wiederum auch aus der le Fortschen Korrespondenz ersichtlich, die freilich mit sehr unterschiedlicher Intensität und Thematik geführt wurde. Im Vordergrund stand meist das Literarische in seinen praktischen Aspekten (Verlage, Übersetzungen). Bemerkbar ist hier jedoch auch die ständige Suche nach einer richtigen Aussage und dem Gehalt der Dichtung, wobei dieses „Tasten“ nun weniger auf die Sicherheit des Dogmas gerichtet war. In ihrer Dichtung suchte sie meist einen passenden Mittelweg zwischen einem allzu engen Konfessionalismus und völliger Offenheit.
Nach Gertrud von le Fort vermeidet das Zentrum die gegensätzlichen Extreme bei der Entwicklung der eigenen Identität. Diese Identität wird von der Autorin in vertrauten Mustern und Formen des Christentums gesucht. Die Begriffe Umkehr und Identität verwendet sie sowohl in ekklesialer Hinsicht, das kirchliche Leben betreffend, als auch in ekklesiologischer Hinsicht, das heißt die Reflexion über das kirchliche Leben betreffend. Stets hebt sie die Notwendigkeit der ständigen Bekehrung der christlichen Gemeinschaft hervor. Mit ihren Spätwerken tritt sie für eine „evangelische Katholizität“ ein, welche die historisch und dem Wesen nach unterschiedlichen Lebens- und Glaubensformen respektiert. „Evangelische Katholizität“ drückte nach Gertrud von le Fort aus, dass den verschiedenen kirchlichen Gestalten eine christliche Einheit zugrunde liegt, wie sie dies insbesondere in den Novellen „Am Tor des Himmels“ (1954) – deren zentrales Thema die zerstörerische Kraft des Atomzeitalters ist – und „Der Dom“ (1968), ihrer letzten, veranschaulichte. Sie sah dabei mit Scharfblick die Gefahren voraus, welche eine bloß formale religiöse „Orthodoxie“ und moralische Gesetzlichkeit mit sich bringen können. Diese schaden der geistigen Entwicklung des Menschen und verhindern somit eine überzeugte Annahme des Heils, das sie mit dem „Kommen des Reiches Gottes“ identifizierte.
Während dieser Zeit kam das „protestantische Erbe“ der Dichterin in ihren Werken stärker zum Vorschein. Wichtiger als dogmatische Konfessionalität schien ihr die Suche nach Wahrheit und Sinn in der säkularisierten Welt zu sein. Es lässt sich demnach eine Entwicklung in Gertrud von le Forts Denken verfolgen: Nach der Akzentuierung des Katholischen in ihrer Dichtung trat dieses zugunsten einer „Erkenntnis der universellen Wahrheit“ zurück. Festzustellen ist dabei, dass Christentum und Kirchlichkeit bei le Fort nicht mehr deckungsgleiche Größen sind, sondern die Letztere macht für sie nur einen Teil des Ersten aus in der Überzeugung, dass sich das Christentum nicht in der Kirchlichkeit erschöpft. Le Fort als Dichterin wurde zunehmend offener und befreite sich von Berührungsängsten und „Ghettomentalität“. Beispielhaft zeigt dies bereits die durchaus kontroverse Aufnahme ihres Nachkriegsromans „Der Kranz der Engel“ in der katholischen Leserschaft. 13
Die unkonventionelle Haltung der Dichterin bewährte sich in ihrem Christentum stets aufs Neue und knüpfte an die Idee der ökumenischen Versöhnung der Christen an. Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass die Grenzen der Katholizität bei Gertrud von le Fort während dieser Zeit verschwanden oder dass sie sich von der kirchenchristlichen Tradition abwandte. Es kann auch nicht vom Weg zu einer neuen Form der Religion im Leben und Spätwerk der Dichterin die Rede sein, wie dies etwa bei Luise Rinser, mit welcher le Fort in den Nachkriegsjahren korrespondierte, der Fall war. Zwischen der Neubelebung des christlichen Glaubens infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und der entsprechenden weltanschaulichen Entwicklung Gertrud von le Forts besteht ein enger Zusammenhang. Wohl kaum ein anderer deutscher Autor setzte sich so intensiv wie sie mit dem durch das Konzil ausgelösten Wandel in Theologie, Exegese, Verkündigung und Gemeindeleben auseinander. Was noch viel wichtiger ist: Noch vor der Wende des Vaticanum Secundum legte sie die Scheuklappen einer veralteten, rechthaberischen Orthodoxie ab. Davon berührt ist auch ein neues Verständnis der katholischen Liturgie, wie sie, getragen von der Frage nach dem Verhältnis zwischen objektiver Heilsgeschichte und individuellem Heilsgeschehen, zunächst innerhalb der Liturgischen Bewegung neu definiert wurde. Mit gemischten Gefühlen begrüßte Gertrud von le Fort jedoch das Verschwinden des Lateins in der katholischen Liturgie, weil „das Credo in ihr [= der lateinischen Sprache] eine in keiner [anderen] Sprache wiederzugebende Macht hat“ und dadurch „sogar in der Fremde ein Heimatgefühl“ geweckt wird. 14Mit ähnlicher Besorgnis begegnete sie dem Beschluss eines Münchener Kardinals, auf die Barockmusik im Gottesdienst zu verzichten. 15
Читать дальше