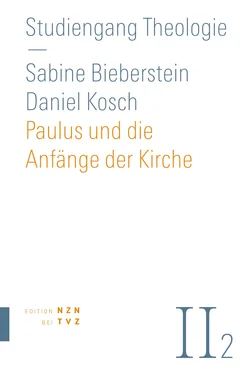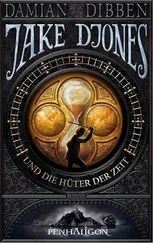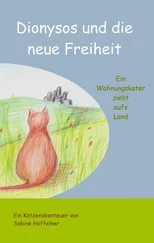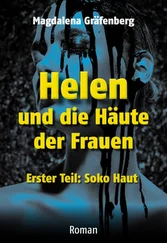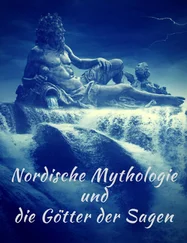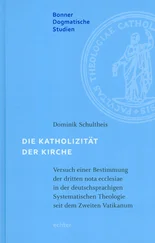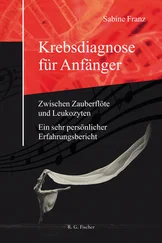In diesen Worten klingt das gewaltsame Prophetenschicksal Jesu an. Sie sind aber auch ein Echo darauf, dass die Verkündigung der Q-Leute unter den Jüdinnen und Juden weitgehend nicht von Erfolg gekrönt war. Dabei deutet die Formulierung «siehe, euer Haus wird euch verlassen (werden)» bereits auf eine spätere Redaktionsphase des Spruchevangeliums Q während des jüdischen Krieges, als entweder das Ende des Jerusalemer Tempels unmittelbar bevorstand oder als bereits auf die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 n. Chr. zurück geblickt wurde.9
Auch wenn sich einige Q-Sprüche also äusserst kritisch mit Israel auseinandersetzen, sind diese Sprüche doch keinesfalls antijüdisch zu lesen, sondern als Zeugnisse innerjüdischer Auseinandersetzungen um die Bedeutung des Propheten Jesus und den Ernst der Entscheidungssituation. Wohl soll Israel mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Umkehr gerufen werden; doch dürfen diese Texte noch nicht als Hinweise auf eine bereits erfolgte Trennung der in Q vertretenen Jesus-Nachfolger vom Judentum verstanden werden. Noch ist diese Jesusgruppe in die vielfältigen jüdischen Richtungen des ersten Jahrhunderts einzuordnen, auch wenn die Texte zeigen, dass sich eine eigene Identität der Jesusbewegung – zum Teil in Abgrenzung von anderen jüdischen Gruppierungen – herauszubilden beginnt.10
1.5
|23| Anfänge in Jerusalem
Eine etwas andere Perspektive auf die nachösterlichen Aufbrüche bietet die Apostelgeschichte des Lukas (Apg). Dieses Werk ist zwar erst um das Jahr 90 n. Chr. entstanden, doch stellt es als einziges uns zur Verfügung stehendes Werk einen erzählerischen Zusammenhang zwischen dem Wirken Jesu und der Zeit nach Ostern her.
Wie andere historische Quellen muss dabei auch das lukanische Doppelwerk kritisch auf die historischen Ereignisse hin befragt werden. Denn der Verfasser des lukanischen Doppelwerkes – der hier mit der kirchlichen Tradition und exegetischen Konvention Lukas genannt wird – tritt nach seiner eigenen Selbstdarstellung als ein akribisch arbeitender Forscher auf, der vorliegende Quellen auswertet, um auf deren Grundlage eine eigene Darstellung der Jesusgeschichte und der Geschichte seiner «Apostel» zu schreiben (vgl. Lk 1,1–4; Apg 1,1 f.). Geschichte zu schreiben heisst nach den Konventionen der griechischen Antike, «die Kräfte zum Vorschein [zu] bringen, die geschichtliche Abläufe vorantreiben.»11 Diese bewegende Kraft ist nach Überzeugung des Lukas der Heilige Geist. Die Kraft dieses Heiligen Geistes war nach Lk 24,49 den in Jerusalem versammelten Jüngerinnen und Jüngern vom Auferstandenen zugesagt worden, und bereits von Beginn der Apostelgeschichte an wird die Bedeutung des Heiligen Geistes als die hinter all den Ereignissen stehende Kraft kenntlich gemacht (Apg 1,2). Der Auferstandene wiederholt nach Apg 1,8 gegenüber der Jüngergruppe die Verheissung der Geistausgiessung. Zugleich wird hier das erzählerische Programm der Apostelgeschichte deutlich:
«Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.» (Apg 1,8)
In seinem zweiten Band will Lukas demnach erzählen, wie sich das Evangelium von Jerusalem über Judäa und Samaria «bis an die Grenzen der Erde» ausbreitet und wie dies von der |24| Kraft des Heiligen Geistes bewirkt und unterstützt wird. Dieses Programm ist zu bedenken, wenn wir uns im Folgenden der Darstellung der «Anfänge der Kirche» in der Apostelgeschichte zuwenden. Es gilt also, die Darstellung der Apostelgeschichte auf die Intentionen des Verfassers hin zu befragen und mit Hinweisen aus (den spärlichen) anderen Quellen kritisch zu kombinieren.
1.5.1
Die Rückkehr nach Jerusalem
Nach der Darstellung der Apostelgeschichte (und schon des Lukasevangeliums) bleiben die Jüngerinnen und Jünger – gemäss der Anweisung des Auferstandenen in Lk 24,49 – während der Passions- und Osterereignisse in Jerusalem. Dem entsprechend werden nicht nur im Lukasevangelium, sondern auch in der Apostelgeschichte die Erscheinungen des Auferstandenen in und um Jerusalem angesiedelt, und auch die so genannte Himmelfahrt, die endgültige Aufnahme des auferstandenen Jesus in den Himmel, wird in Betanien bzw. auf dem Ölberg nahe der Stadt Jerusalem lokalisiert (Lk 24, 50–53; Apg 1,9–12). So entsteht das Bild einer ununterbrochenen Präsenz der Jesusgruppe in Jerusalem über Karfreitag und Ostern hinweg.
Doch ist es demgegenüber historisch durchaus wahrscheinlich, dass viele der massgeblichen Jesusanhängerinnen und -anhänger nach der Verhaftung und Kreuzigung Jesu zunächst aus Jerusalem geflohen und nach Galiläa zurückgekehrt sind (vgl. Mk 14,50 f.).12 Auch einige der Erscheinungstraditionen deuten, wie bereits erwähnt, nach Galiläa als Ort visionärer Jesusbegegnungen nach Ostern (Mk 16,7; Mt 28, 16–20; Joh 21).
Allerdings muss ein Teil der Jesusanhängerschaft – darunter Mitglieder des Zwölferkreises und andere Repräsentanten, nicht jedoch die Q-Gruppe – aus Galiläa dann doch wieder nach Jerusalem zurückgekommen sein. Vielleicht gründet deren Motivation darauf, dass sie die Auferweckung Jesu als Teil des endzeitlichen Umwälzungsprozesses interpretierten, der zur endgültigen Durchsetzung der Gottesherrschaft führen |25| würde.13 Denn nach jüdischen Traditionen wurden die Ereignisse der Endzeit in Jerusalem erwartet, so dass es nachvollziehbar wird, dass die Jesusanhänger mit ihren hohen Erwartungen dort sein wollten, um «selbst den Platz der Parusie besetzt zu halten, gleichsam als eschatologische Vorposten, als die Wächter auf den Zinnen der Stadt, die der Welt und insbesondere den Zerstreuten das Kommen des himmlischen Königs künden sollten, wenn es soweit war (Jes 52,8)»14.
1.5.2
Eine aussergewöhnliche Erfahrung am Anfang
In seiner Pfingstgeschichte (Apg 2,1–13) erzählt Lukas, wie die von Jesus verheissene Geistausgiessung (Apg 1,8) sich realisierte: Die in Jerusalem versammelte Jesusgruppe wird am Pfingsttag von dieser Geistkraft erfüllt und verändert. Damit steht auch nach der Darstellung der Apostelgeschichte eine aussergewöhnliche Erfahrung am Anfang der Ausbreitung der Jesusbotschaft. Das Geschehen wird zunächst als ein hörbares Phänomen beschrieben, indem von einem Brausen wie von einem Sturm die Rede ist (Apg 2,2), es ist aber auch visuell erfahrbar: Es wird von Zungen wie von Feuer gesprochen, die sich auf alle verteilen (Apg 2,3). Und schliesslich ist die Wirkung auf die Anwesenden mehr als erstaunlich, denn alle reden nun in fremden Sprachen (Apg 2,4). Vielleicht hat Lukas in Apg 2,1–4 eine ältere Tradition verarbeitet, die von ekstatischen Erfahrungen erzählte, die zu einem geistgewirkten Zungenreden führten.15 Auch die Erscheinungstraditionen in 1 Kor 15,3–7 sprechen von aussergewöhnlichen Erfahrungen, von denen sich eine vor einer Gruppe von 500 Glaubensgeschwistern ereignet habe. Die johanneische Tradition spricht ebenfalls von einer Geistübermittlung durch den Auferstandenen am Ostertag (Joh 20,21–23). Zwar sind diese durchaus unterschiedlichen Traditionen keinesfalls in eins zu setzen; doch weisen sie auf aussergewöhnliche Erfahrungen der Jesusanhängerinnen und -anhänger bald nach |26| dem Tod Jesu hin, die sie als endzeitliche Ereignisse deuteten und in deren Folge sie sich, von neuer Kraft erfüllt, zur Verkündigung des Gekreuzigten und von Gott Auferweckten gesandt wussten.
Bei der erzählerischen Ausgestaltung jener Erfahrungen stehen prophetische Texte im Hintergrund, die für die Endzeit die Ausgiessung des Geistes erwarten und an die in der Pfingsterzählung angeknüpft wird (Joël 3,1–5; Jes 59,21; Ez 36,23–28; 39,29). Damit werden auch diese Jerusalemer Anfangsereignisse in den Horizont eschatologischer Erwartungen gestellt. Möglicherweise klingen auch Motive der Sinaioffenbarung an, wie eine Schrift des jüdischen Theologen und Philosophen Philo von Alexandria (geboren ca. 15/10 v. Chr.) über den Dekalog und speziell zu Ex 19,16 ff. nahelegen könnte:
Читать дальше