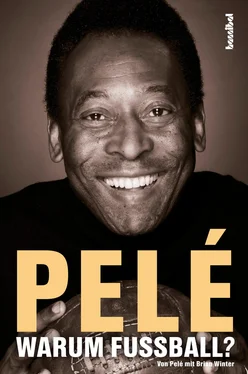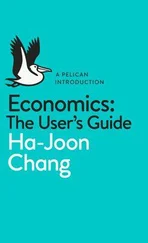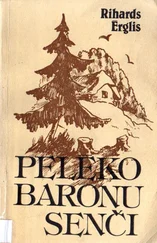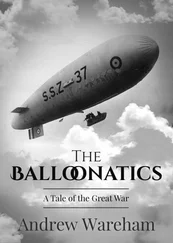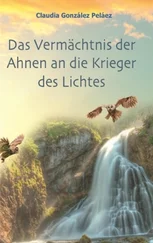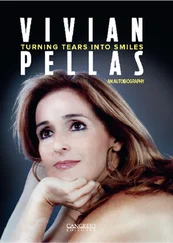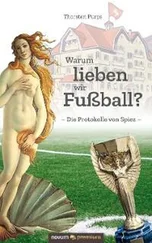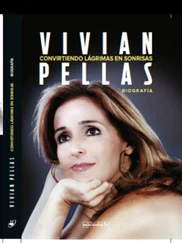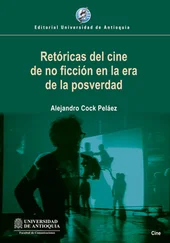Wir konnten außerdem mit der bestmöglichen Ausrichtungsstätte für dieses Spiel aufwarten: dem brandneuen Maracanã-Stadion in Rio, das speziell für diese Weltmeisterschaft erbaut worden war. Durch seine ehrfurchtgebietenden Ausmaße und seine architektonische Verspieltheit erinnert es mehr an einen Kaiserpalast als an ein Stadion. Es war viel Geld in diese Spielstätte investiert worden, da dort schließlich das Heimteam zum Champion gekrönt werden sollte. Die brasilianische Regierung hatte über 10.000 Arbeiter angeheuert, und als das Stadion fast fertig war, testeten sie die Standfestigkeit, indem sie die Ränge füllten und imaginäre Tore bejubelten. Zum Glück hielten alle Stützen und Träger der Belastung stand. Als das Maracanã schließlich stand, war darin Platz für fast 200.000 Zuschauer. Es war somit das größte Stadion der Welt, größer noch als der Hampden Park im schottischen Glasgow, der 40.000 Zuschauer weniger aufnehmen konnte.
Die brasilianischen Medien und Politiker überschlugen sich förmlich vor Lob für das Maracanã und im weiteren Sinne Brasilien selbst. Die Zeitung „A Noite“ etwa schrieb: „Brasilien hat nun das größte und perfekteste Stadion der Welt, das dem Können seines Volkes und dem Fortschritt in jedem erdenklichen menschlichen Betätigungsfeld zur Ehre gereicht. Endlich verfügen wir über eine Bühne epischen Ausmaßes, in der die ganze Welt unser Prestige und unsere sportliche Größe bewundern kann.“
Und diese Form der Übertreibung war noch gar nichts im Vergleich zu der Begeisterung, die am Spieltag herrschte. Karnevalsumzüge ergossen sich durch die Straßen von Rio, und die unmittelbar bevorstehende Krönung Brasiliens zur weltbesten Mannschaft wurde besungen. Viele nahmen sich den Tag frei und deckten sich voller Vorfreude auf die wilden Feiern, die nach dem Spiel stattfinden würden, mit Bier und Snacks ein. Eine Zeitung druckte sogar ein Foto unseres Teams auf der Titelseite und ließ sich zu der Schlagzeile hinreißen: „Das sind die Weltmeister!“
Als das brasilianische Team auf das Spielfeld lief, durfte es sich über ein ausverkauftes Haus freuen. Geschätzte 200.000 Menschen – bis heute ein Weltrekord für ein Fußballspiel – waren ins Stadion geströmt. Noch vor dem Spiel wurden den Spielern goldene Uhren überreicht, in die eine Widmung eingraviert worden war: „Für die Weltmeister.“ Und dann ergriff auch noch der Gouverneur von Rio de Janeiro das Wort und richtete sich an das Team, die Zuschauer und die Nation:
„Ihr Brasilianer, die für mich bereits die Sieger dieses Turniers sind … Ihr Spieler, die ihr in wenigen Stunden von euren Landsleuten umjubelt werdet … Niemand in irdischen Sphären kann euch das Wasser reichen … Ihr seid jedem Gegner überlegen … Ich verbeuge mich bereits jetzt vor euch und eurem Triumph!“
Inmitten all dieser Ausschweifungen gab es nur eine warnende Stimme. Allerdings kam die aus einer beunruhigenden Richtung.
„Das ist hier kein Schaulaufen. Es ist ein Spiel wie jedes andere – nur viel schwerer“, informierte Brasiliens Trainer Flávio Costa die Reporter noch vor dem Spiel. „Ich fürchte, die Spieler werden aufs Feld laufen, als wäre der Stern für den Titel bereits auf ihre Trikots genäht.“
- 9 -
All dies fordert eine Frage heraus: Mensch, Brasilien, was sollte dieser ganze Hype?
Waren wir etwa so naiv? Dämlich?
Oder ging es um noch etwas anderes?
Eine Sache habe ich im Lauf der Jahre gelernt – und manchmal auf die harte Tour. Das Geschehen auf dem Spielfeld ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Das trifft nicht nur auf Brasilien zu, sondern auf alle Länder der Welt. Man muss auch einen Blick hinter die weißen Linien der Spielfeldbegrenzung riskieren – die Leben der Spieler, die Teams an sich und, sehr oft zumindest, die politische Situation des jeweiligen Landes in Betracht ziehen, um zu verstehen, was wirklich vor sich geht.
Während der Weltmeisterschaft 1950 war es ganz besonders offensichtlich, dass der Sport nur ein Teil des großen Ganzen war. Zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal, sahen die brasilianischen Politiker das Turnier als eine goldene Möglichkeit, den Ruf unseres Landes aufzubessern – und natürlich auch ihren eigenen. Zu dieser Zeit wurde Brasilien nämlich noch vielerorts, in Europa und den USA zumindest, als rückständige Bananenrepublik wahrgenommen, in der Cholera und die Ruhr an der Tagesordnung waren und hauptsächlich Indianer und unkultivierte Ex-Sklaven lebten. Wenn sich das barsch und politisch unkorrekt anhört, dann nur, weil es das auch war. Allerdings war es eine Sicht der Dinge, die sogar viele brasilianische Würdenträger teilten, etwa der Bürgermeister von Rio de Janeiro, der erklärte, dass die WM die Möglichkeit biete zu beweisen, dass wir keine „Wilden“ seien. Brasilien könne sich mit den reichen Ländern der Welt messen – und sie sogar übertrumpfen.
Das war natürlich eine grob einseitige Sichtweise, da Brasilien mit seinen vielen positiven Eigenschaften in Wirklichkeit schon seit langem als charmanter Eigenbrötler existiert hatte. Tatsächlich ist auch die Geschichte unserer Unabhängigkeit eine, in der es um Verlockung und Verführung geht. Anders als der Großteil Südamerikas wurde Brasilien nicht von den Spaniern, sondern von den Portugiesen kolonialisiert. 1808 floh die portugiesische Königsfamilie vor Napoleons Truppen aus Lissabon und verlegte ihren Hof nach Rio de Janeiro. Somit waren sie die ersten Royals, die jemals eine ihrer Kolonien betraten und sogar dorthin zogen. Es sagt schon etwas aus, dass auch einige Vertreter der Königsfamilie – darunter Pedro I, der Sohn des Prinzregenten – sich entschieden zu bleiben, nachdem Napoleons Heerscharen keine Gefahr mehr darstellten.
Warum? Nun, ich war schon sehr oft in Lissabon, und es ist eine echt coole Stadt. Aber in Rio gibt es Strände voller Pulversand, wie Halbmonde geformte Buchten, üppig bewaldete Berge und wunderschöne, gastfreundliche Menschen. Pedro I konnte jeden Vormittag von seinem Palast aus eine kurze, von Palmen gesäumte Straße hinunterspazieren, um schnell mal in die Flamengo-Bucht zu hüpfen. Von dort konnte er dann den Anblick des Zuckerhuts genießen. Als ihm seine königlichen Verwandten 1822 schließlich einen Brief schrieben, in dem sie seine Rückkehr nach Portugal forderten, tat er das einzig Logische – er teilte ihnen mit, dass sie sich zur Hölle scheren sollten: „Fico!“ Er würde bleiben. Und so erlangte Brasilien seine Unabhängigkeit ohne jegliches Blutvergießen. Das genaue Datum war der 7. September, der Tag, nach dem sich meine erste Fußballmannschaft benannte. Der Tag ist auch heute immer noch als Tag des „Fico“ bekannt. Es ist eine nette Geschichte und keine Übertreibung. Schließlich muss man nicht ein Monarch sein, um Brasilien genießen zu können. Viele Millionen von Einwanderern zog es nach Brasilien, sie waren von den Möglichkeiten und Menschen verzaubert und beschlossen, sich niederzulassen. Aber die Geschichte von Pedro I gibt auch Aufschluss darüber, warum unsere Volksvertreter 1950 so aufgeregt waren. Seit der Unabhängigkeit war über ein Jahrhundert vergangen, aber politisch lag immer noch einiges im Argen. Seit „Fico“ war Brasilien von einer Krise in die nächste getaumelt und musste eine Reihe von Revolutionen, Staatsstreichen und regionalen Unruhen über sich ergehen lassen. Nur zwei Jahrzehnte zuvor hatte sich São Paulo vergeblich gegen die Regierung in Rio erhoben. Im Zweiten Weltkrieg kämpften brasilianische Soldaten tapfer auf der Seite der Alliierten für die Demokratie – um nach dem Krieg in eine Diktatur heimzukehren.
Als die Weltmeisterschaft nach Brasilien kam, bewegten wir uns langsam nach vorne, doch unsere Rolle in der modernen Welt schien noch immer unklar. „Brasilien war ein Land ohne Ruhm, das gerade eine Diktatur hinter sich gelassen hatte und noch unter den Nachwehen der Regierungszeit des Präsidenten Dutra litt“, schrieb Pedro Perdigão in seinem Buch über die WM 1950. Anders gesagt: Unsere Politiker hatten das Gefühl, etwas unter Beweis stellen zu müssen. Und sie zählten auf den Fußball, der ihnen dabei helfen sollte.
Читать дальше