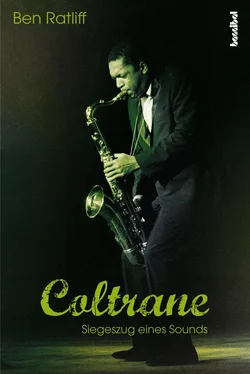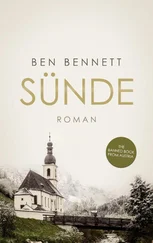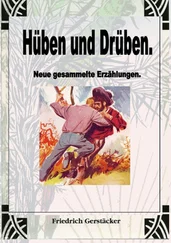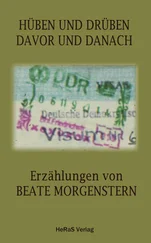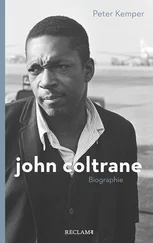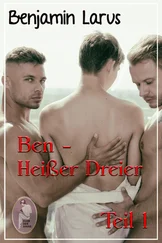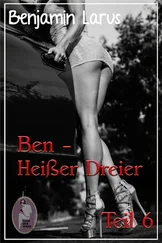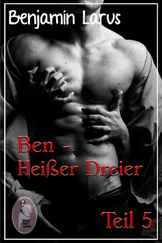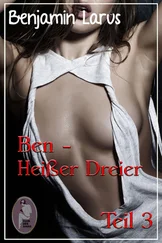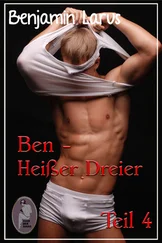Gillespies Orchester existierte von 1946 bis 1950. Er hatte die kleinen Plattenfirmen der ersten Bebop-Experimente hinter sich gelassen. RCA bezahlte nun seine Aufnahmen. 1947 spielte er mit dem Orchester „Manteca“ ein, eines der wichtigsten Jazzstücke aller Zeiten – und Ursprung des modernen Afro-Latin-Jazz. Zu dem Zeitpunkt jedoch, als Coltrane den Posten des Lead-Altsaxofonisten übernahm (die erste Stimme der Saxofongruppe, die feste, komponierte Melodien spielte), war das Ende bereits in Sicht. Die Engagements gingen zurück. Bis zum Ende des Jahrzehnts war das Orchester auf sechs oder sieben Mitglieder zusammengeschrumpft. Einige Auftritte dieser Band aus dem Jahr 1951 haben auf Raubkopien überlebt. Sie stellen die nächsten wichtigen Aufnahmen Coltranes seit der Aufnahme auf Oahu dar. Hie und da ist er als Solist zu hören, kraftvoll, wahrhaft und improvisierend. Er wird weder vom Donner einer Big Band hinweggefegt, noch lässt er sich bei einem Sänger-plus-Orchester-Job in den Hintergrund drängen. Seine Entwicklung als Musiker ist bemerkenswert. Und warum auch nicht? Immerhin sind fünf Jahre vergangen, für einen jungen Mann eine lange Zeit. Er hat Zugriff auf mehr Töne, doch die Logik seines Spiels ist immer noch wirr, immer noch chaotisch. Was aber hören wir 1951 schon von dem späteren, reifen Coltrane? Er schimmert zumindest an manchen Stellen durch. In den nächsten vier Jahren, bis er in die Band von Miles Davis einstieg, arbeitete er jedoch lediglich weiter an der Verfeinerung seiner Grundkenntnisse.
Coltrane spielte in Gillespies Big Band vermutlich nur selten Tenorsaxofon. Abseits der Bühne übte er aber wie ein Besessener auf dem größeren Blasinstrument und baute auf den Erfahrungen auf, die er in Vinsons Band gemacht hatte. Er verwendete Übungsskalen von Carl Czerny und Charles-Louis Hanon und übte verschiedene Arpeggio- und Intervallmuster, manche davon mit wechselnden Registern durch sämtliche Tonarten der westlichen Musik. Sie waren als Fingerübungen für Pianisten gedacht und nicht gerade das typische Übungsmaterial für einen Bläser.
Zur Zeit der 1951 entstandenen Aufnahmen hatte er einen eigenen Stil entwickelt, der in sich aber noch kaum schlüssig war. Er verband exotische Skalen und eine Rhythm & Blues-Rhetorik mit sturen, langgezogenen Tönen und den Anfängen eines wachsenden Interesses für die tiefen und hohen Lagen.
Das beste Solo der Bootlegaufnahmen mit Gillespie aus dem Jahr 1951 – es gibt aus dieser Zeit keine offiziellen Studioaufnahmen mit einem Solo von Coltrane – findet sich in Gillespies „A Night In Tunisia“ vom 6. Januar.
Wir wissen durch sein Zitat des Mittelteils in der 1946 entstandenen Oahu-Aufnahme von „Hot House“ bereits um Coltranes Verbindung zu „A Night In Tunisia“. Man kann annehmen, dass es ein Song war, den er regelmäßig zur Übung spielte; er mag sich daran gewöhnt haben, über seine Auf-und Abwärtsbewegungen zwischen den verschiedenen Mollakkorden zu improvisieren. Dieses „Tunisia“-Solo, ein Schema lang, hat seine Schwächen: Es quietscht, ist ein bisschen unentschlossen und manchmal unbeabsichtigt dissonant. Doch es hat Charakter. Es beginnt mit einem Break wie aus dem Bilderbuch: Plötzlich hören alle Musiker mit Ausnahme des Solisten auf zu spielen. Als Parker die Nummer fünf Jahr zuvor aufnahm, war sein Break vier Takte lang, in denen er einen Schwarm von Sechzehntelnoten um die Konzerttonart F kreisen ließ. Es ist ein berühmter Break, und in aller Regel spielt ihn niemand kürzer als vier Takte. Coltranes Break ist jedoch seltsamerweise nur zwei Takte lang und besteht aus längeren Tönen, die eine Harmonie erzeugen, die sofort in Richtung Moll tendiert. Wenn die Band einsetzt, heizt sich sein Swingfeeling auf, aber nur ganz allmählich. Insgesamt vermittelt dies ein Gefühl von Geduld, Ausdauer, wenn nicht gar von Dissoziation; von einer Ernsthaftigkeit, die beinahe unglaublich ist; als ahnte er, dass Band und Publikum auf die Offenbarung irgendeiner künstlerischen Wahrheit warteten. Es ist der Außenseiter, der ein offenes Feld betritt, wo die Angriffe von allen Seiten kommen können – er ist defensiv korrekt, langsam und vorsichtig.
Es ist ein Trancezustand, und zwar ein typisch amerikanisch-romantischer; eine Disposition, die außerhalb historischer Markierungen angesiedelt ist. Sie zieht das Starren dem Blinzeln vor. Johnny Cash, Clint Eastwood, Waylon Jennings waren in diesem Zustand, auch Tommy Duncan, der große Bariton des Western-Swing von Bob Wills & His Texas Playboys. Oder Walt Whitman, als er seine Gefühle in langen Zeilen nach außen kehrte, sich aber doch hinter Wiederholungen versteckte wie ein wirbelnder Derwisch in seinem Gewand. Auch Gertrude Stein lässt sich mit ihren Wiederholungen in einem knappen amerikanischen Rhythmus dazurechnen. (T. S. Eliot sagte einmal abfällig, ihr Stil biete „ein besonderes hypnotisches Muster, dem man bisher noch nicht begegnet ist; es ist mit dem Saxofon verwandt“.) Natty Bumpoo, der Held in James Fenimore Coopers Lederstrumpf-Erzählungen, hatte diese Einstellung, ebenso wie John Wayne als Ethan in Der schwarze Falke: Sie passten sich der Lebensweise der Indianer an und fanden einen eigenen Weg, um außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen ihrer Rasse, Klasse oder ihres Status bestehen zu können.
Jazz fördert und hemmt diese Disposition gleichermaßen. Es ist Musik in einem sozialen und kommerziellen Kontext, verbunden mit harter Arbeit. Man spielt, um das Geld für die Miete zu verdienen. Der Clubbesitzer gibt einem eine feste Gage oder einen Teil der Eintrittseinnahmen, und wenn die Gäste während des Auftritts mehr trinken als sonst, wird man wieder gebucht. Man spielt in dem beengten Kontext einer Band, als Teil einer Instrumentengruppe oder als führender Solist und gibt dem Publikum möglichst das, was es will. Gleichzeitig improvisiert man und versucht, jenen Teil der eigenen Persönlichkeit ans Tageslicht zu bringen, der sich am deutlichsten von allen anderen unterscheidet.
„Was ich bei Diz nicht wusste, war, dass meine Aufgabe darin bestand, mich wirklich selbst auszudrücken“, erzählte Coltrane 1956 Ira Gitler, einem Reporter von Down Beat. „Ich spielte Klischees und versuchte angesagte Melodien zu lernen, damit ich mit den Typen spielen konnte, die sie spielten.“ Das ist nicht ganz zutreffend, wenn man sich das Solo von „Night in Tunisia“ ansieht, denn es weicht deutlich von der Norm ab. Jedoch darf man nicht vergessen, dass wir hier von John Coltrane reden – einem der wichtigsten Musiker des amerikanischen Jazz, der die Tradition begründete, nicht wie irgend jemand anders zu klingen. Zutreffend hingegen ist im Großen und Ganzen, dass er sich in der grundlegenden Wahl seiner Töne und Spielmuster letztlich an den großen Saxofonisten der Vierzigerjahre orientierte, die Charlie Parkers Sprache auf das Tenorsaxofon übertragen hatten: Dexter Gordon, Wardell Gray und Gene Ammons.
Diese Musiker verwendeten Parkers rhythmisches Feeling, gaben dem Ganzen jedoch eine rauere, erdigere Gestalt; es war leichter, ihnen zu folgen als Bird. Sie fanden den Weg zurück zur melodischen Sicherheit und Sensibilität für Balladen eines Lester Young und kamen dabei dem kunstvollen Hupkonzert von Illinois Jacquet sehr nahe, der für seine weltlichen Extreme bekannt wurde und seine Soli entweder wie Ziegelsteine von sich schleuderte oder als Küsse hinhauchte. Alle fanden ihr Publikum auf landesweiten Tourneen mit Big Bands, fernab vom intellektuellen Kern der New Yorker Bop-Szene. Sie entdeckten das tiefe Ende des Bebop – im wörtlichen Sinne der Tonhöhe wie auch im metaphorisch-gefühlsmäßigen Sinne (man könnte auch sagen: erdig, erdverbunden). Es ist kein Zufall, dass sie in der neuen Musik einen Dialekt entwickelten, der besonders das schwarze Publikum ansprach.
Im Herzen des Bebop, in seiner ersten Apotheose mit Charlie Parker (Altsaxofon), Bud Powell (Piano), Dizzy Gillespie (Trompete) und dem ersten Schwung Schlagzeuger (Kenny Clarke, Max Roach, Art Blakey, Stan Levey und Roy Haynes) bestand der Sound aus drei Hauptelementen. Diese waren das Ride-Becken, das den schnellen Rhythmus zum großen Teil trug (während die „Bomben“ der Basstrommel in unregelmäßigen Abständen abgeworfen wurden), die rechte Hand des Pianisten (Powell ließ die Einzeltöne fast immer wie Drachen in der Luft tanzen, mit gelegentlichen Sturzflügen in Form stechender Akkorde mit der linken Hand) und schließlich die hohen Register des Altsaxofons und der Trompete, die in ausgedehnten Improvisationen Vorstöße in Richtung neunter, elfter oder dreizehnter Stufe wagten. Parker hat seinen Moment der Erleuchtung in einem berühmten Interview einmal so beschrieben: „Ich entdeckte, dass ich genau das spielen konnte, was ich mir vorgestellt hatte, wenn ich die höheren Lagen eines Akkords als Melodielinie verwendete und sie mit entsprechenden Harmoniewechseln unterlegte. So erwachte ich zum Leben.“ Später erklärte er regelmäßig, sein Interesse für Debussy und Bartók, die solche Intervalle ebenfalls verwendeten, sei erst geweckt worden, als Gillespie ihre neue Sprache bereits für sie formuliert hatte.
Читать дальше