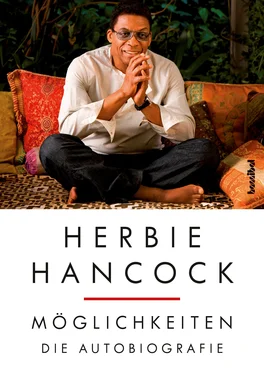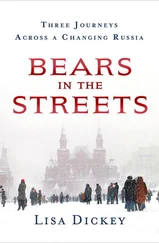übersetzt von Alan Tepper

www.hannibal-verlag.de
Impressum
Die Autoren: Herbie Hancock mit Lisa Dickey
Deutsche Erstausgabe 2018
Titel der Originalausgabe:
„Possibilities“ von Viking, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC, 375 Hudson Street, New York, New York 100014
© 2014 by Herbert J. Hancock
Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com
Coverfoto: © Douglas Kirkland
Fotos Innenteil © Herbie Hancock, außer anders erwähnt
Übersetzung: Alan Tepper
Lektorat und Korrektorat: Dr. Matthias Auer
© 2018 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-651-3
Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-650-6
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Widmung
Für mein unbezahlbares Juwel, meine wunderschöne Frau Gigi, und unseren wertvollen Schatz, unsere hübsche Tochter Jessica
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Bildstrecke
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Danksagungen
Für weitere Informationen
Das könnte Sie interessieren

Mitte der Sechziger in einer Konzerthalle in Stockholm. Ich sitze auf der Bühne vor dem Klavier und spiele mit dem Miles Davis Quintett. Wir befinden uns auf einer Tournee, und diese Show heizt sich langsam auf. Die Band ist tight – alle synchron, alle auf derselben Wellenlänge. Die Musik fließt, wir haben eine Verbindung zum Publikum hergestellt, und es fühlt sich magisch an, als würden wir einen Zauber beschwören.
Tony Williams, das Drummer-Wunderkind, der bei Miles als Teenager einstieg, glüht förmlich. Ron Carters Finger flitzen auf dem Basshals auf und ab, und Wayne Shorters Saxofon schreit und kreischt. Aus uns fünfen ist eine Einheit geworden, die sich im Flow der Musik hin- und herbewegt. Wir spielen „So What“, einen von Miles’ Klassikern, und nähern uns rasant seinem Solo. Es ist der Höhepunkt des Abends, und das Publikum sitzt – bildlich gesprochen – erwartungsvoll auf der Stuhlkante, spürt die Erregung.
Miles beginnt seinen Part, baut das Solo auf und holt kurz Luft, bevor er sich gehen lässt. Und exakt in dem Moment spiele ich einen Akkord, der unglaublich falsch ist. Ich weiß gar nicht, woher er kam – es ist ein falscher Akkord an der falschen Stelle, und er liegt nun wie der Geruch von fauligem Obst in der Luft. Oh, Scheiße! Wir alle kreierten dieses herrliche Klanggemälde, und ich habe aus Versehen ein Streichholz darunter entzündet.
Miles zögert den Bruchteil einer Sekunde und spielt dann einige Töne, die meinen Akkord wie durch ein Wunder korrekt erscheinen lassen. Ich glaube, dass ich exakt in dem Moment mit offenem Mund dasaß. Was war das für eine Alchemie? Und danach nahm er die Melodie auf und entfachte ein Solo, das den Song in eine neue Richtung führte. Die Menschenmenge rastete aus.
Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in den frühen Zwanzigern und hatte Miles schon seit einigen Jahren begleitet. Doch er war immer noch in der Lage, mich zu verblüffen und zu erstaunen, was er an dem Abend auch machte, indem er den Akkord von „falsch“ nach „richtig“ modulierte. Nach dem Auftritt sprach ich ihn in der Garderobe darauf an. Ich fühlte mich ein wenig verlegen, doch Miles winkte ab, der Hauch eines Lächelns auf seinem scharfgeschnittenen Gesicht. Er sagte nichts. Das musste er nicht. Miles war niemand, der viel redete, wenn er uns stattdessen etwas beibringen konnte.
Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was in dem Moment auf der Bühne geschehen war. Sobald ich den Akkord angeschlagen hatte, bewertete ich ihn. Meiner Auffassung nach war es ein „falscher“ Akkord. Miles hingegen fällte kein Urteil – er hörte einen Klang, der gerade entstanden war, und interpretierte ihn als eine Herausforderung, als eine Frage des: „Wie kann ich den Akkord in das integrieren, was wir gerade spielen?“ Und weil er nicht bewertete, konnte er damit umgehen, daraus etwas Neues und Erstaunliches entstehen lassen. Miles vertraute der Band, er vertraute sich selbst, und er ermutigte uns, diesem Beispiel zu folgen. Das war eine der zahlreichen Lektionen, die ich von ihm lernte.
Wir alle haben die allzu menschliche Tendenz, den sicheren Weg einzuschlagen – das zu machen, von dem wir wissen, dass es funktioniert –, und verpassen damit die sich bietenden Chancen. Doch das ist die Antithese des Jazz, der von der Präsenz des Augenblicks lebt. Beim Jazz erlebt man den Moment, und zwar in jeder Facette. Der Jazz beinhaltet das Selbstvertrauen eines Musikers, blitzschnell zu agieren. Gestattet man sich das, wird man niemals mit dem Erforschen und dem Lernen aufhören, was sowohl für die Musik als auch das Leben gilt. Ich hatte das große Glück, dies nicht nur beim Spielen mit Miles zu lernen, sondern auch in den folgenden Jahrzehnten, in denen ich Musik machte.
Und ich lerne es noch immer, jeden Tag aufs Neue. Es ist ein Geschenk, das ich niemals hätte vorhersehen können, als ich im Alter von sechs Jahren auf dem Klavier meines Freundes Levester Corley herumklimperte.
Levester Corley wohnte im selben Gebäude wie meine Familie, an der Ecke der 45st Street/King Drive in der South Side von Chicago. Wir lebten in einer armen Gegend, doch es war nicht die schlimmste in den Vierzigerjahren dort, möglicherweise eine Stufe darüber, was bedeutete, nicht in einer Sozialwohnung zu hausen, doch in der Nähe dieser Wohnprojekte. Ich habe unser Viertel damals nicht als „schlecht“ eingeordnet, obwohl es in einigen Straßen recht hart zuging. Dort gab es Gangs, und am Ende des Blocks befand sich ein baufälliges und von uns so bezeichnetes „Big House“, Slang für ein Gefängnis. Ständig hingen junge Männer vor dem Big House ab, und wenn man sie sah, wusste man, dass es ratsam war, die Straßenseite zu wechseln. Doch meist fühlte ich mich sicher und nicht bedroht. Ich nahm an, dass meine Nachbarschaft der anderer ähnelte.
Ich wurde 1940 geboren. Als ganz kleines Kind glaubte ich, wir seien reich, da uns alles zur Verfügung stand, was wir haben wollten. Wir hatten Kleidung, genügend Essen und jedes Jahr einen Weihnachtsbaum und Spielzeug. Wie hätte ich das anders empfinden können als mit dem Gefühl, „reich zu sein“? Ich hatte noch nie jemanden getroffen, der außerhalb des Viertels lebte, und verglichen mit einigen anderen Familien des Blocks, schien es uns gutzugehen. Im Keller unseres Hauses wohnte eine Familie mit zehn Mitgliedern, die sich in einem einzigen Raum drängten. Im Vergleich dazu standen uns zwei Schlafzimmer für fünf Bewohner zur Verfügung – für meine Eltern, meinen Bruder Wayman, meine Schwester Jean und mich. Das fühlte sich wie purer Luxus an.
Читать дальше