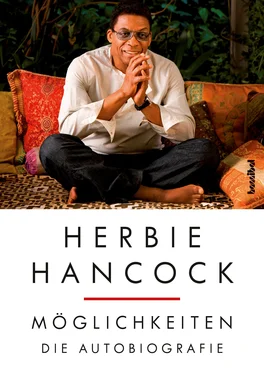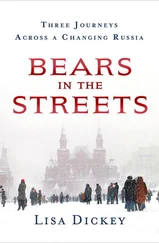Da das Quintett niemals probte, begann ich mein Experiment eines Abends direkt auf der Bühne. Ich musste mich so sehr konzentrieren, dass es eher einer Übung glich, ähnlich dem Spielen von Tonleitern, und nicht reiner Musik. Die Läufe klangen unregelmäßig, und ich musste ständig aufhören, da meine Finger automatisch zu den Terzen und Septimen wanderten. Ich empfand mein Spiel als unbeholfen, bekam an dem Abend aber mehr Applaus als in der ganzen Woche. Das Publikum spürte, dass ich meine Grenzen überschritt, etwas Neues versuchte, und die Leute mochten es.
Normalerweise besteht ein Akkord aus drei Grundnoten. Da ich nun die „Buttertöne“ vermied, reduzierte sich der volle Akkord auf ein oder zwei Noten. Manchmal spielte ich zwei nebeneinanderliegende Noten, also Sekunden. Doch ich schlug nie die Terzen und Septimen an, wodurch die Akkorde offen klangen. Das ermöglichte dem Solisten mehr Raum, gab ihm verschiedenste Wahlmöglichkeiten der Richtung, die er einschlagen wollte. Das klang minimalistisch und ungewöhnlich, doch am wichtigsten war mir eine neue Perspektive, um die Musik zu betrachten und das der Improvisation zugrundeliegende kompositorische Element.
Nachdem ich mich erst mal an ein Spiel ohne „Buttertöne“ gewöhnt hatte, begab ich mich auf den umgekehrten Weg und setzte sie wieder ein. Nun waren es allerdings keine „Buttertöne“ mehr: Ich spielte sie nicht, weil ich es musste, so wie früher. Ich spielte sie, weil ich es wollte. Und das änderte alles für mich – und das nur, nur weil Miles die vier Worte gesagt hatte.
Eine kleine Anekdote. Jahre später kam mir das Gerücht zu Ohren, Miles habe mir tatsächlich geraten, auf die tiefen Töne zu verzichten [„bottom notes“], was ich angeblich missverständen hätte [„butter notes“]. Wie auch immer: Diese vier Worte, die ich hörte – oder die ich zu hören glaubte – veränderten mein Leben.
Tony Williams war beim Einstieg ins Quintett erst siebzehn Jahre alt. Das stellte ein Problem dar, denn er war zu jung, um sich in den Clubs aufzuhalten, in denen wir auftraten. Miles riet ihm, sich einen Bart wachsen zu lassen, doch sogar dann sah Tony noch wie der Teenager aus, der er war.
Clubbesitzer versuchten damals, die Altersbeschränkung mit einigen Tricks zu umgehen. Sie trennten einen Teil des Clubs für jüngere Gäste mit einer Kordel ab, wo man der Klientel nur Mineralwasser ausschenkte. Manchmal verzichteten sie sogar ganz auf den Alkoholausschank, wenn Tony die Bühne betrat. Wir spielten einen Gig, bei dem Miles einen anderen Drummer für das erste Set engagierte, damit die Leute ihr System genügend „auftanken“ konnten. Als Tony die Bühne betrat, wurde der Alkoholausschank dann eingestellt. Einige Zuschauer bei den „Konzerten ohne Alkohol“ nahmen an, Miles sei auf einen möglichst stillen Club bedacht, da er die Musik so ernst nehmen würde, dass ihn das Klickern der Eiswürfel in den Drinks gestört hätte. Doch der ganze Aufwand fand nur wegen seines Schlagzeugers statt.
Miles liebte Tonys Stil, weshalb er auch auf andere Kompromisse einging. Zum ersten Mal seit Wochen spielten wir damals alle Nummern in einem hohen Tempo, flogen förmlich, sogar bei Balladen – alles lief boom-boom-booom ab, gelegentlich dreimal so schnell wie das Grundmetrum. Das war unglaublich aufregend, aber auch extrem anstrengend. Eines Tages hatten wir genug davon und inszenierten eine Revolution. Ron ging zu Miles und sagte mit Nachdruck: „Es wird uns zu viel, jedes Mal so schnell zu spielen. Wir brauchen einige langsamere Nummern und sollten einige Balladen auch wie Balladen spielen.“ Danach achtete Miles auf ein eher gemischtes Programm.
Zuerst konnte ich mir nicht erklären, warum Miles das schnellere Tempo für die Band anvisierte. Als ich darüber nachdachte, schien mir, dass er es wegen Tony machte. In den frühen Tagen des Quintetts fühlte sich Tony bei mittleren oder langsamen Tempi unwohl. Da er aber so ein wichtiger Faktor in der Band war, wollte Miles vermutlich seine Stärken betonen, während Tony musikalisch reifte. Ich habe ihn nie danach gefragt, und somit könnte ich mit dieser Vermutung auch danebenliegen. Allerdings ist es die einzige Schlussfolgerung, die mir einfällt.
Miles und Tony hatten eine intensive und aufreibende Beziehung, sowohl persönlich als auch finanziell. Tony lebte in einem Apartment, das Miles gehörte, einige Stockwerke über ihm. Manchmal krachte es bei den beiden auch, was Themen wie Miete oder die Gage anbelangte. Tony konnte ein richtiger Hitzkopf sein, und er rieb sich an Miles, ähnlich einem Bock, der sein Geweih in einen Baumstamm rammt. Gelegentlich sprachen sie nicht mehr miteinander, und jeder meckerte über das, was der andere angestellt habe. Während dieser Phasen antwortete Miles schroff und zischend, wenn wir etwas diskutieren wollten: „Fragt nicht mich, fragt ihn.“ Doch um nichts in der Welt hätte ich mich in solchen Situationen in die Schusslinie zwischen den beiden begeben.
Tony erdreistete sich sogar, Miles’ Spiel zu kritisieren. Das hörte ich allerdings erst geraume Zeit später. Tony studierte die Musik wie ein Besessener, lernte alles über verschiedene Stilistiken, was sogar so weit ging, dass er alle Parts bestimmter Stücke auswendig draufhatte. Manchmal begann er einen Vortrag über das „modale Tonleitersystem der europäischen Harmoniegeschichte, zurückreichend ins zwölfte Jahrhundert“, als sei es ein Lehrfach, von dem wir alle wüssten. Er arbeitete so obsessiv, dass ihn Miles irritierte, der sein Interesse an Proben und Studien nicht teilte.
„Mann, warum übst du nicht?“, fragte Tony frei heraus, als sei es völlig normal, wenn ein Schlagzeuger im Teenageralter den bedeutendsten Trompeter seiner Generation belehrte, einen Mann, alt genug, um sein Vater zu sein. Tonys einziges Kriterium, ob ein Musiker einen anderen kritisieren durfte, war Talent – weder Alter noch Erfahrung, sondern nur Talent zählte. Jahre später meinte Bryan Bell – der Mann, der einen Großteil der elektronischen Musiktechnologie entwickelt und praktisch umgesetzt hatte – zu Tony, er sei ein großartiger Schlagzeuger. Tony antwortete: „Bryan, du bist nicht gut genug, um so ein Urteil zu fällen.“
Bryan fühlte sich vor den Kopf gestoßen, doch er antwortete: „Mir gefiel deine Performance.“
Darauf antwortete Tony: „Das darfst du sagen.“
Hatte Tony einen Zwist mit einem der Musiker des Quintetts, dann bestrafte er denjenigen, indem er bei dessen Solo die Drum-Begleitung verweigerte. Er hörte einfach auf, ließ ihn in der Luft hängen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Tony war gelegentlich sehr temperamentvoll und launisch, doch egal, welche Probleme den Stimmungsschwankungen zugrunde lagen – sie wurden durch seine „monströsen“ Fähigkeiten relativiert. Da er so jung war, ließen wir ihm seine Launen durchgehen. Als Teenager spielte er mit der heißesten Jazz-Band der Szene. Sich plötzlich in so einer Situation wiederzufinden, hätte auf jeden einen ungeheuren Druck ausgeübt.
Während der Jahre mit Miles wurde Tony ein enger Freund. Bevor Wayne einstieg, war er mein Kumpel in der Band, der, mit dem ich mich am intensivsten über das Leben, die Musik und andere Themen unterhielt. Er trieb sich erbarmungslos an, um ein besserer Musiker und Komponist zu werden, und ich lernte so viel von ihm wie von den damaligen Kollegen, zu denen ich aufschaute. Tony glaubte an seine Fähigkeiten, aber suchte immer einen Lehrer, auch wenn es sich um keine pädagogisch ausgebildete Kraft handelte. Ständig studierte er, lernte dazu.
Als Tony die Songs für sein erstes Album Life Time komponierte, saß er vor dem Piano und „pflückte“ sich die Melodien mit dem Zeigefinger, wie ein kleines Kind, das gerade mit dem Klavierspiel beginnt. Er wollte kein Pianist werden, sondern benötigte nur ein Vehikel zum Ausarbeiten von Melodien. Ich verbrachte Stunden damit, ihm zu helfen, transkribierte die von ihm gespielten Melodien und versuchte dann, mittels „trial and error“ die Harmonien zu finden, die ihm vorschwebten. Tonys Songs ließen sich als komplex beschreiben, waren so ganz anders als simple Popsongs und sicherlich nicht zum Mitsingen geeignet.
Читать дальше