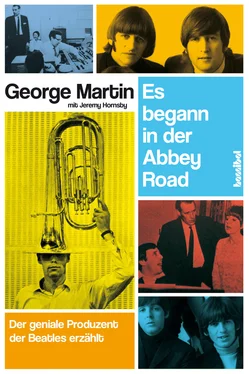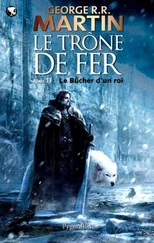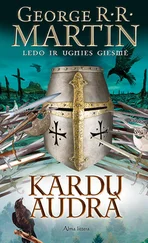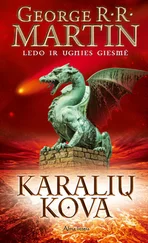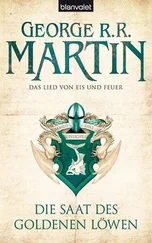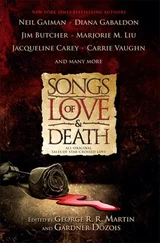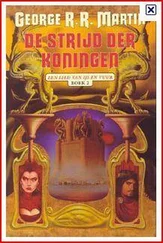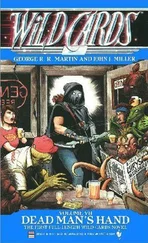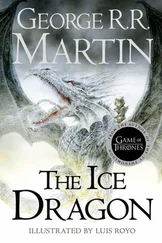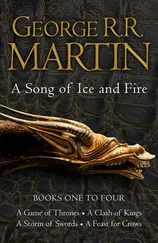Edison hatte recht. Er ließ einen Streifen dünnes Wachspapier unter der Nadel herlaufen und schrie: „Hallo!“ Als er das Papier ein zweites Mal durch die Maschine laufen ließ – man glaubt es kaum –, hörte er sein „Hallo“. Das konnte man noch nicht als quadrophonischen Sound bezeichnen, aber zumindest war ein Anfang gemacht worden. Ende des Jahres ließ er den Phonographen patentieren, mit dessen Hilfe er Aufnahmen auf eine um einen Zylinder gewickelte Zinnfolie machte. Er hatte den Beweis mit der nun unsterblichen Zeile „Mary had a little lamb“ erbracht. Die Aufnahmeindustrie war geboren.
Heute, über 100 Jahre danach, steht der Interessierte vor der kuriosen Tatsache, dass sich die danach folgende Entwicklung in Abschnitte von jeweils 25 Jahren unterteilen lässt.
Die ersten 25 Jahre dauerten bis kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert. Sie waren von einer hektischen und fieberhaften internationalen Suche gekennzeichnet, bei der jeder versuchte, das neue Spielzeug der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Während dieser Periode erfand Emil (englisch: Emile) Berliner die flache und plane Scheibe und ein Gerät, auf der er sie abspielen konnte – das Grammophon.
Doch der erste größere Durchbruch fand 1901 mit den auf hartem „Thermoplastik“ produzierten Platten statt und 1904, als die erste doppelseitige Schallplatte auf den Markt kam. Damit wurde die zweite Ära eingeläutet, die man als „akustische Phase“ bezeichnen kann. Nun, da zufriedenstellende mechanische Verfahren der Klangreproduktion erfunden worden waren, suchte man nach klanglichen Verbesserungen hinsichtlich der Aufnahme und des Abspielens der jetzt so genannten Schallplatten. Man wendete viel Zeit und Arbeit auf, um die beste theoretische und praktische Form des Schalltrichters zu gewährleisten, dessen Größe und Gestalt sich maßgeblich auf die Klangwiedergabe auswirkte.
Die mechanische Reproduktion bestimmte die „akustische Phase“. Dann – wie auf einen Startschuss hin – begann 1925 die Ära der elektrischen Aufzeichnung. Nun aktivierte die Membran bei einer Aufnahme die Nadel nicht mehr physisch, da die Vibrationen in elektromagnetische Impulse umgewandelt wurden, die sich dann auf die Nadel übertrugen. Beim Abspielen der Platte ließ sich die neue Technologie in der Umkehrung natürlich auch anwenden.
Innerhalb der nächsten 25 Jahre verfeinerte und entwickelte man die Technologie, bis exakt zum Jahr 1950, in dem zufälligerweise ein argloser junger Mann namens George Martin der Musikindustrie beitrat. Genau zu dem Zeitpunkt begannen die vierten 25 Jahre, die Ära der „elektrischen“ Tonaufzeichnung. Und damit hatte ich Glück – und Gott hatte ein ungewöhnliches gutes „Lebensrhythmusgefühl“ für mich bewiesen. Darum betrachte ich das Buch vor allem als die Geschichte dieser 25 Jahre moderner Tonaufzeichnung.
Ich empfinde es als zutiefst beeindruckend, dass der Zyklus in eine neue Ära übergeht. Während der Niederschrift des Texts nähern wir uns dem Ende der Tonbandaufzeichnung. Wenn Sie dieses Buch in den Händen halten, befinden wir uns schon in der nächsten Phase – dem digitalen Zeitalter. Doch das hebe ich mir für das letzte Kapitel auf.
GEORGE MARTIN

Ich wurde von einem unerbittlichen Klingeln geweckt. Das war kein guter Start in den heutigen, nein, jeden Tag. Einen Moment lang überlegte ich, wo ich mich befand. Ich lag im Schlafzimmer eines Pariser Hotels, und es war nicht Morgen, sondern mitten in der Nacht.
Zuerst musste ich ein dringliches Problem lösen, und zwar das höllische Gebimmel beenden. Ich nahm den Hörer ab und flüsterte ein leises und fragendes „Hello?“.
„George, es tut mir leid, dich zu wecken, aber ich muss dir unbedingt von den Neuigkeiten berichten.“
Brian Epsteins leicht lallende Stimme klang sehr aufgeregt. Um diese Uhrzeit schon oder noch angetrunken? Doch schnell erfuhr ich den Grund dafür.
„Ich komme gerade von einer Feier mit den Jungs, und sie sind genauso aus dem Häuschen wie ich“, keuchte er mit einer sich überschlagenden Stimme und wartete einen Augenblick, um die Spannung zu steigern. Ich sagte nichts, denn es war zu früh am Morgen oder zu spät in der Nacht, um einen anständigen Satz zu formulieren. Dann ließ er die Bombe hochgehen.
„Wir sind nächste Woche auf dem ersten Platz der US-Charts. Das ist ganz sicher. Ich habe gerade mit New York telefoniert.“ Das war’s also. Wir hatten es endlich geschafft, und zwar mit dem Song „I Want To Hold Your Hand“. Nach einem Jahr mühseliger und schwerer Arbeit hatten wir endlich die Mauer des größten Tonträgermarkts der Welt durchbrochen.
An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken, doch das machte mir nichts aus. In den letzten zwölf Monaten gehörte eine geregelte Nachtruhe zu den seltenen Annehmlichkeiten des Lebens. Ich lag im Bett, dachte an die Vergangenheit und die sich uns in der Zukunft bietenden Möglichkeiten.
Allerdings gab es zwei Gründe, warum ich mit den Beatles nach Paris gekommen war, und die standen im Moment ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Sie standen vor ihrem ersten Frankreichauftritt im Olympia, und den durfte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Darüber hinaus wollten wir noch schnell eine Platte in dem EMI-Studios Paris aufnehmen.
Ende 1963 hatten wir Großbritannien musikalisch erobert. Nun – wie auch in den USA – versuchten wir den großen Siegeszug auf dem Kontinent fortzusetzen. Die EMI-Vertreter in Deutschland hatte anscheinend ein Anflug von Patriotismus gepackt – wer kann das schon genau wissen –, und sie bestanden auf einer deutschsprachige Single, denn nur so ließen sich angeblich hohe Verkaufszahlen erzielen. Die Jungs hielten das für blanken Unsinn, und auch ich glaubte den deutschen EMI-Managern kein Wort, wollte ihnen aber keinen Anlass geben, einen möglicherweise schlechten Umsatz unserer Starrköpfigkeit zuzuschreiben.
Und so überredete ich John und Paul nach einigen Wortgefechten zu einer Neuaufnahme von „She Loves You“ und „I Want To Hold Your Hand“. Der Text wurde uns freundlicherweise von einem Deutschen übersetzt, der sich bei der Aufnahme blicken ließ, um die korrekte Aussprache zu prüfen. Ich konnte den Akzent nicht einschätzen, merkte aber schnell, dass es sich um eine wortwörtliche Übersetzung handelte. „Sie liebt dich, ja, ja, ja …“ klang in meinen Ohren wie eine für Peter Sellers charakteristische Parodie.
Wir setzen die Aufnahme für einen Tag an, an dem die Beatles nicht für die Olympia-Show proben mussten. Ich fuhr zum Studio, erwartete jedoch nicht, sie dort anzutreffen. Schon damals waren die Beatles kein Musterbeispiel für Pünktlichkeit. Nach einer Stunde Warten entschied ich mich, sie im Hotel anzurufen.
Keiner der vier wollte das Telefonat entgegennehmen. Neil Aspinall, ihr Tourmanager, wurde von ihnen vorgeschickt, um das Gespräch zu führen. Er klärte mich darüber auf, dass sie sich letztendlich gegen die Aufnahme entschlossen hatten und nicht kommen würden. Meine Reaktion als „verärgert“ zu bezeichnen hieße, den Mount Everest als einen mittelgroßen Hügel zu beschreiben. „Du wirst ihnen sagen“, brüllte ich in den Hörer, der vermutlich vor Entsetzen rot anlief, „du wirst denen jetzt sagen, dass ich mich direkt auf den Weg mache, um ihnen meine ungeschminkte Meinung zu verklickern.“
Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Es war das erste Mal, dass die Jungs sich gegen mich auflehnten. Es irritierte mich, dass sie nicht den Mut besaßen, es mir direkt ins Gesicht zu sagen. Wutentbrannt raste ich zum Hôtel Georges Cinq, wo sie in einer extravaganten Suite wohnten, und platzte in den Salon der luxuriösen Unterbringung. Ich fühlte mich unmittelbar in eine Szene aus einem Buch von Lewis Carroll versetzt, dem Autor von Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Es fehlte nur noch das weiße Kaninchen. John, Paul, George, Ringo, Neil Aspinall und Mal Evans, sein Assistent, saßen um einen langen Tisch herum. In ihrer Mitte stand Jane Asher, eine wunderschöne Alice mit langem, goldenem Haar, und goss ihnen Tee ein. Mein plötzliches Auftauchen versetzte die Beatles in Angst und Schrecken. Wie von einem Wirbelsturm gepackt, trieb es sie in alle Richtungen. Die vier versteckten sich hinter dem Sofa, einem Berg aus Kissen und dem Piano – alles, was ihnen Schutz bot.
Читать дальше