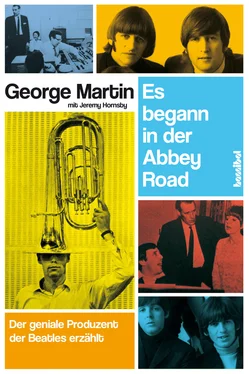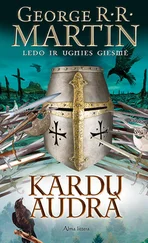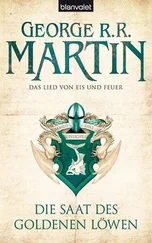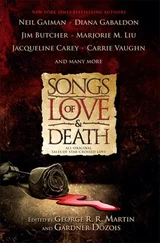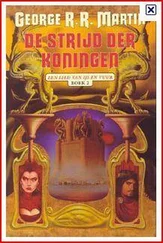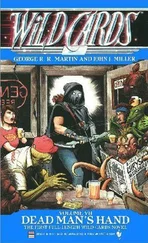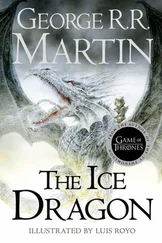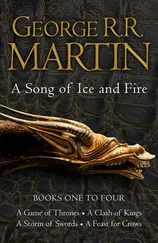Neben den Meetings versammelten sich die einzelnen Labels zu einem monatlichen Verlagstreffen. Dabei hörten wir die neuen Stücke. Damals verfügten Interpreten und Verleger über keine Homerecording-Möglichkeiten, und so besuchten uns die verschiedene Vertreter – gebucht von Judy in 15-minütigen Intervallen – und sangen und klimperten uns ihre aktuellen Werke auf dem großen Flügel (der stand in unserem Büro) im guten, alten Tin-Pan-Alley-Stil vor. Wir machten uns Notizen und behielten Kopien der Noten. Ich hatte meinen Spaß dabei, da es mich an die Zeit der Varietés erinnerte und in der Tradition von George Gershwin stand, der als unbekannter Künstler auch seine Stücke feilbieten musste. Es lässt sich überhaupt nicht mit den polierten und durchproduzierten Demobändern vergleichen, die man uns heute präsentiert.
Da die Besprechungen vormittags stattfanden, hatte ich den Nachmittag für Aufnahme-Tests im Studio 2 zur Verfügung. Jede halbe Stunde kündigte sich ein neuer Interpret an. Damals verfügte Judy über ein wesentlich größeres Wissen über Pop und Jazz als ich. Sie nahm sich manchmal frei, flog in den Pariser Blue Note Club und hatte ihren Spaß mit dieser Szene.
Verglichen mit heute war das Geschäft meist weniger dramatisch, sensationsheischend und aufgesetzt. Es war ganz einfach Arbeit, obwohl eine höchst interessante, von der die Menschen, die sich außerhalb dieses Kreises bewegten, so gut wie gar nichts erfuhren. Kaum jemand hielt den Job eines Plattenproduzenten für erstrebenswert, was im eindeutigen Gegensatz zu heute steht, wo sich alle darum reißen und ihnen jedes Mittel recht ist, um sich zu etablieren.
Sogar die Rivalität unter den diversen Sub-Labels der EMI kann noch als gentlemanlike bezeichnet werden. Wir schnüffelten niemals nach Büroschluss in den Aktenordnern der anderen herum, um einen Vorteil zu erlangen, um zu wissen, was bei ihnen vor sich ging. Es bestand eher eine Parallele zum Automobilhersteller British Leyland, wo man leicht einen Mitarbeiter finden konnte, der auf seine Firmenzugehörigkeit stolz war: „Einmal ein Austin-Mann, immer ein Austin-Mann“. Auf uns übertragen hieß dass dann: „Einmal ein Columbia-Mann, immer ein Columbia-Mann.“
Dennoch hütete Oscar sein Täubchen Parlophone wie eine Henne ihre Küken (wenn dieser Vergleich ornithologisch überhaupt zulässig ist). Niemand durfte seinem Label zu nahe kommen. Allerdings gab es zeitweise nicht viel Arbeit bei Parlophone, da die Firma nach dem Krieg viele Interpreten verloren hatte. Einige Künstler wurden von Label zu Label verschoben, und so führte Oscar auch Produktionen für Columbia durch, da er bestimmte Musiker noch von Parlophone kannte und sie ihm ans Herz gewachsen waren. Zum Beispiel nahm er Robert Wilson auf, der eigentlich zu HMV gehörte.
Allerdings bestanden einige unumstößliche Gesetze. Parlophone produzierte niemals ein Musical, denn dieses Genre betreute HMV exklusiv. Die Differenzierung der Labels erstreckte sich sogar bis in die Geschäfte. Heutzutage werden Schalllatten überall verkauft. Damals konnte man Tonträger nur in Fachgeschäften erwerben, die wiederum nur ein Label vertrieben – ein Shop für HMV, ein anderes Geschäft für Columbia und so weiter. Speziell HMV hegte einen regelrechten Standesdünkel und war stolz auf ihre Läden. HMV-Platten durften nur von HMV-akkreditierten Verkäufern dem Endkunden angeboten werden. Darüber hinaus erlaubten sie nur eine Verkaufsstelle in einer Stadt. Die Innenausstattung jeweiligen Geschäfte machte der von Rolls Royce Konkurrenz. Die Filialleiter fühlten sich regelrecht geehrt, wenn eine Tafel mit dem Zeichen des Hundes mit dem Grammophon über ihrer Eingangstür hing.
Ich empfand das als nicht sonderlich intelligent, da sie den Umsatz freiwillig und absichtlich beschnitten. Am Ende zerbrach das Geschäftsmodell, und HMV-Platten waren überall zu kaufen. Das aber führte zu einer massiven Auseinandersetzung mit der EMI. Ein Mann, der den alten Zeiten partout nicht Lebewohl sagen wollte, empörte sich so sehr, sodass der letzte Ausweg für ihn in einer Kündigung bestand. So eine Entscheidung mag aus heutiger Sicht dumm anmuten, belegt und betont jedoch den starken Wunsch der Menschen, ihre Individualität beizubehalten.
1952 war die Zeit für mich reif, meine Identität zu suchen. Ich schlug Peter Ustinov vor, gemeinsam mit meinen Kollegen von der London Baroque Society eine Platte zu machen. Peter war das Enfant terrible der britischen Schauspielzunft, unsere Antwort auf Orson Welles. Da er das Publikum immer mit seiner sogenannten „Mundmusik“ erheiterte, entschieden wir uns für die doppelseitige Single „Mock Mozart“/„Phoney Folk Lore“. Die A-Seite beschreibe ich gerne als dreiminütige Mini-Oper von Peter. Ich kategorisierte die Produktion unter dem Überbegriff „The Voices And Noises Of Peter Ustinov“. Peter sang alle Teile, also Sopran, Altstimme und Tenor, und wurde von Anthony Hopkins auf dem Spinett begleitet.
Das Ganze entwickelte sich zu einem kleinen Abenteuer. Natürlich verfügten wir damals noch über keine Mehrspurtechnik. Da er im Grunde genommen ein vierköpfiges Ensemble imitieren musste, war Peter gezwungen, mit sich selbst zu singen. Dazu benutzten wir zwei Bandmaschinen und mischten dabei gleichzeitig. Natürlich war das alles noch in Mono, wodurch wir natürlich Generationen an Aufnahmequalität verloren. „Generationen“ bedeutet das prozentuale Verhältnis zwischen Signal und Geräusch. An dieser Stelle sollte ich den technisch eher Desinteressierten etwas über den mechanischen Aufnahmeprozess erklären. Die Aufnahmequalität wird von der Qualität/Quantität der Moleküle des Bandes an sich bestimmt. Das Verhältnis des ursprünglichen Signals zum Hintergrundrauschen – damit meine ich die kaum wahrnehmbaren Geräusche des Bandes, die durch den rein physischen Prozess des Anliegens am Tonkopf entstehen – bestimmt das Endresultat.
Das Verhältnis des ursprünglichen Signals, also der Tonquelle, zum Hintergrundrauschen verändert sich durch den mechanischen Abrieb, verkleinert sich also zugunsten des Hintergrundrauschens. Während bei der ersten Aufnahme das Rauschen noch eindeutig im Toleranzbereich liegt, nimmt es bei einer erneuten Aufnahme auf ein anderes Band zu. Je öfter dieser Prozess wiederholt wird, desto stärker hörbar wird das Phänomen. Jede weitere Aufnahme verschlechtert also das gewollte Tonsignal und verstärkt die Störgeräusche um den Exponenten 2. Bei zwei Aufnahmen wird das Rauschen viermal höher, bei drei Aufnahmen sogar neunmal. Dieser Faktor verringerte sich deutlich mit der Entwicklung der Bandaufnahmetechnik, da technisch ausgefeiltere Tonköpfe, ein leichterer Druck des Bandes gegen den Tonkopf und vor allem deutlich besseres Bandmaterial zu klanglich besseren Ergebnissen führten. Im Fall von Ustinov nahmen wir vier Mal auf, und darum verstärkte sich das Rauschen sechzehnmal. Doch ein Großteil des Publikums hört die Geräusche noch nicht mal. Ich glaube zudem, dass die Käufer der Platten noch nicht ahnten, dass der Hintergrundpegel so hoch war. Allerdings würde es den heutigen Hi-Fi-Puristen sicherlich auffallen.
Nun standen wir noch vor einem zusätzlichen Problem. Obwohl die Theorie der mehrfachen Stimmen machbar anmutete, ergab sich bei den Aufnahmen ein Problem. Ich fand heraus, dass Peter im Studio Schwierigkeiten hatte, zu der schon mitgeschnittenen Spur, auch „Track“ genannt, seines Gesangs zu singen. Wie viele andere war er ein „Kopierer“. Um synchron zu der ersten Stimme zu singen, musste er sie zuerst hören und setzte zeitlich versetzt kurz danach an – was natürlich zu spät ist.
Somit arbeiteten wir in kleinen Häppchen. Ich hetzte ständig vom Regieraum zu Peter und zurück. Zwischendurch gab ich ihm Anweisungen: „Hör zu, Peter. Bitte sing diesen Teil ti dum, ti dum, ti dum – und beginn exakt, wenn ich dir mit meiner Hand ein Signal gebe.“ Somit konnte er den genauen Anfangspunkt der Phrase erkennen und passend dazu die Melodie singen.
Читать дальше