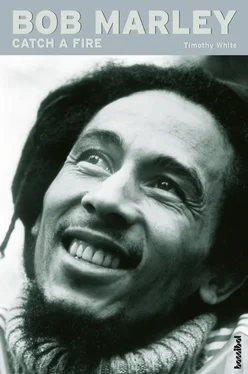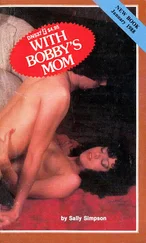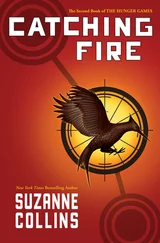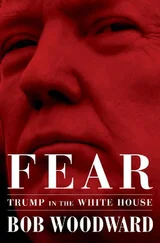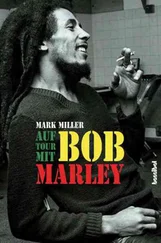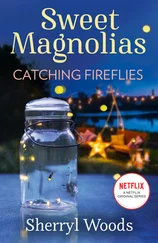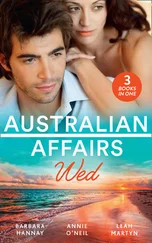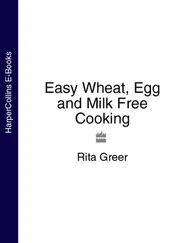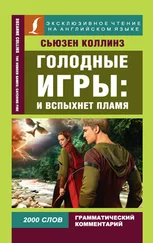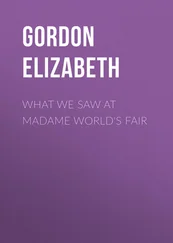Am nächsten Morgen schenkte Salomon ihr einen Ring, in den das Siegel des Löwen von Juda eingraviert war. Er wies sie an, ihn ihrem erstgeborenen Sohn zu schenken, und den Jungen, wenn er reif genug war, zu ihm zu schicken, damit er ihn erziehen könne. Während der langen Heimreise nach Äthiopien schenkte Makeda einem Jungen das Leben, den sie Ebna Hakim nannte, was ›Sohn des Weisen‹ bedeutet.
Als Ebna in Saba aufwuchs, wurde er wegen seiner unehelichen Geburt fortwährend von seinen Gefährten gehänselt. Als Heranwachsender konnte er den Spott und die Kränkungen nicht mehr ertragen. Zornig und verwirrt nahm er allen Mut zusammen, den er zuvor nicht aufgebraucht hatte, und fragte seine Mutter nach dem unbekannten Vater. Erfreut berichtete sie ihm von Salomon und zeigte ihm seinen Ring.
Der in seiner kühnen Einfachheit geschmackvolle Ring war anders als alles, was Ebna je gesehen hatte. Anfangs widersetzte er sich, als Makeda ihm den Ring an den Finger stecken wollte, doch dann nahm er ihn und tat es selbst. Die Wirkung auf Ebna war beunruhigend – ihm war, als ströme plötzlich ein Schwall gezackter, brennender Energie durch seinen Körper. Da es ihm peinlich war, so fassungslos vor seiner Mutter zu stehen, bemühte er sich, seine Angst zu zügeln, doch das Durcheinander in seinem Geist wollte sich nicht legen. Als er einen Versuch machte, sich den Ring vom Finger zu ziehen, begann seine Hand heftig zu zittern. Von Schwindel ergriffen und schweißgebadet hielt er Makeda den Ring hin, doch sie wollte ihn nicht zurücknehmen. »Es ist ein Männerring und das Geschenk eines Königs«, sagte sie zu ihrem Sohn, und dann schickte sie ihn zu seinem Vater, damit er von ihm lerne.
Als Ebna vor dem König stand, erfuhr er zu seinem Ärger und Erstaunen eine schroffe Abweisung, da Salomon ihn für einen Schwindler hielt. »Ich erkenne meinen Sohn«, donnerte er, »an dem Ring, den er trägt!« Beschämt holte Ebna den Ring hervor, und der Zorn seines Vaters verwandelte sich in Trauer. »Du fürchtest dich vor seiner Macht«, sagte Salomon, »doch seine Macht kommt aus dir. Du musst lernen, dich mit deinem Schicksal abzufinden.«
Ebna verbrachte viele glückliche Jahre an Salomons Hof, aber schließlich entschied er, »in die Berge seines Mutterlandes« zurückzukehren. Der König, enttäuscht darüber, dass Ebna nicht sein Nachfolger werden wollte (Salomons ältester Sohn Rehoboam war nämlich ein reichlich frivoler Geist), gestattete ihm nur unter einer Bedingung, abzureisen: Er sollte die belesensten Söhne seines persönlichen Beraters mitnehmen, damit sie in Äthiopien das hebräische Gesetz lehrten. Ebna war einverstanden, doch der Berater und seine Söhne widersetzten sich, da sie glaubten, sich aus der Reichweite der besonderen Gnade und des Schutzes Gottes zu entfernen, wenn sie Israel verließen.
Von ihrer Unverschämtheit erzürnt, stellte Salomon die Söhne des Beraters unter einen heiligen Bann. Daraufhin kapitulierten sie zwar, aber sie sannen auf Rache. Azarius (auch Eleazar genannt), der Sohn des Hohepriesters Zadok, brütete eine Intrige aus, um die Bundeslade zu stehlen und heimlich nach Äthiopien zu schaffen, um sich Jehovas Nähe zu versichern. Der Plan wurde ohne Ebnas Wissen ausgeführt.
Als Salomon erfuhr, was geschehen war, sandte er Reiter aus, um die Karawane zu überwältigen, doch Jehova, über seine Schwelgereien und seine Eitelkeit erzürnt, verwirrte die Reiter des Königs und brachte die Karawane dazu, so schnell zu reisen, dass sie ihr Ziel Monate vor dem festgelegten Termin erreichte.
Und so, erläuterte Tafari den Priestern am Ende seines Monologs, fand die Bundeslade mit Jehovas Segen eine neue ständige Heimat in Äthiopien, und Ebna, der Salomons Ring am Finger trug, wurde Kaiser und nahm den Namen Menelik an.
Nach und nach erwachte der Neid der anfänglich vor der Kraft und Schönheit von Tafaris Vortrag demütigen Priester, und sie argwöhnten über den Detailreichtum, mit dem der Junge die biblische Geschichte ausgeschmückt hatte. Sie wollten wissen, welches seine Informationsquellen seien.
Statt auf dieses Ersuchen zu antworten, wandte Tafari sich an einen Mönch, der in der Kathedrale von Azum gedient hatte, in der man die Bundeslade aufbewahrte. Er beschrieb ihm leise das ›kedusta kedussan‹, das Allerheiligste, in dem die ›tabbot‹ –
Bundeslade – steht, und rezitierte verschiedene sie zierende Inschriften. Der Schock seiner Enthüllung soll den Mönch, der einer Ohnmacht nahe war, dazu gebracht haben, sich die Ohren zuzuhalten, um die blasphemischen Worte nicht zu hören. Er und die restlichen Priester zerstreuten sich in aller Eile.
Später schlossen sie ein feierliches Abkommen, um alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, den jungen Tafari daran zu hindern, die Macht über das Land zu erringen. Er war zu gefährlich – unvorstellbar gefährlich.
Die Geschichten über Tafaris frühe Begegnungen mit den Priestern und seine okkulte Weisheit sowie seine unheimlichen Kräfte verbreiteten sich wie Buschfeuer 1930 in Äthiopien, als sich das Land darauf vorbereitete, Ras Tafaris Gelöbnis zu erfüllen, seine Krönung im November werde die großartigste und feierlichste sein, die Afrika je erlebt habe.
Es war Gesetz, dass alle innerhalb der Landesgrenzen erlegten Löwen in den Besitz des Kaisers übergingen, des siegreichen Löwen des Stammes Juda. Monate vor der Krönung schickte man einen Ballen Löwenfelle nach London, um sie von einem Schneider in der Bond Street zu zeremoniellen Gewändern verarbeiten zu lassen. Tafaris Gesandte erwarben in Europa Gold und Edelsteine im Wert von einer Million Dollar; auch sie wurden nach England gebracht, um sie zusammen mit Salomons Siegel und der Mähne des Löwen von Juda in zwei Kaiserkronen einzuarbeiten. (Die Kronen mussten pünktlich fertiggestellt und den koptischen Priestern in Addis Abeba persönlich übergeben werden, damit sie die vorgeschriebenen einundzwanzig Tage vor der Krönung mit ihnen beten konnten.) Zudem erwarb man die Staatskarosse Wilhelms II.,
ein Gespann schneeweißer Habsburger-Hengste und engagierte einen österreichischen Kutscher, der zuvor in den Diensten von Kaiser Franz Joseph gestanden hatte, um den Kaiser und die Kaiserin zu fahren.
In Addis Abeba wurden neue Straßen angelegt, vorhandene erweitert, und eine große Anzahl neuer Gebäude, Monumente, Torbögen und Statuen wurde errichtet, um an das große Ereignis zu erinnern, das für den 2. November festgesetzt worden war. Einladungen an Würdenträger in aller Welt gingen hinaus, und die Gäste begannen Mitte Oktober einzutreffen. Mit dem Schiff landeten sie im Hafen von Dschibuti am Golf von Aden im damaligen Französisch-Somaliland, und ihre Reise in das gebirgige Innere von Äthiopien erfolgte mit einer Eisenbahn, die eigens für den 780 Meilen langen Weg auf den neuesten technischen Stand gebracht worden war.
Zu denen, die am Monatsende eingetroffen waren, gehörten Isaburo Yoshida aus Japan, Marschall Franchet d’Esperey aus Frankreich, Konteradmiral Prinz Udine aus Italien, der griechische Graf Metaxas, Baron H.K.C. Bildt aus Schweden, Muhammad Tawiq Pascha aus Ägypten und der Herzog von Gloucester, der eine tonnenschwere Hochzeitstorte überbrachte. Hindenburg schickte fünfhundert Flaschen erstklassigen Rheinweins, und die französische Regierung stellte ein Privatflugzeug. Sonderbotschafter Herman Murray Jacobs, den Herbert Hoover beauftragt hatte, die Vereinigten Staaten zu vertreten, war jedoch mit den meisten Geschenken beladen: Neben einem signierten und hübsch gerahmten Foto des Präsidenten hatte er eine Bestandsliste nichtamtlicher, privat erworbener Geschenke mitgebracht. Sie umfassten einen stromgespeisten Kühlschrank, eine rote Schreibmaschine mit dem Wappen der kaiserlichen Streitkräfte, einen Radio-Phonographen, einhundert Platten ›echt amerikanischer Musik‹, fünfhundert Rosenstöcke – einschließlich einiger Dutzend der sogenannten Präsident Hoover-Sorte, einer neue Amaryllisart, die das US-Landwirtschaftsministerium entwickelt hatte –, eine gebundene Ausgabe von National Geographic, einen gebundenen Bericht über die Abessinien-Expedition des Chicago Field Museum und Kopien der Filme ›Ben Hur‹, ›King of Kings‹ und ›With Byrd at the South Pole‹.
Читать дальше