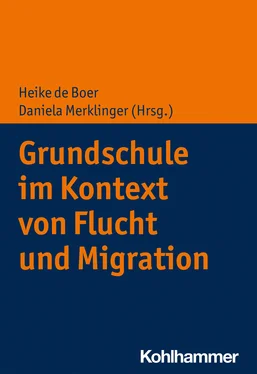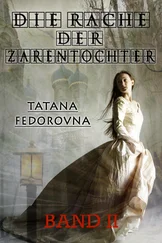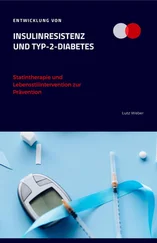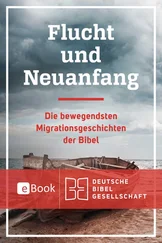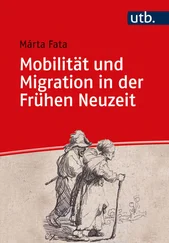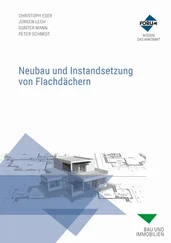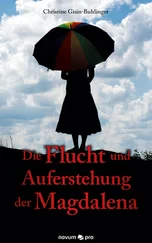Um Geflüchtete Kinder und Traumatisierung geht es in dem Beitrag von Christine Bär. Dabei wird zunächst ein Verständnis von Flucht zugrunde gelegt, nach dem diese kein punktuelles, traumatisierendes Ereignis, sondern vielmehr einen langjährigen Prozess darstellt, der nach der Ankunft im Aufnahmeland noch lange nicht aufhört. Denn insbesondere in den ersten Jahren nach gelungener Flucht können die unsicheren und bedrohlichen Aufenthaltsbedingungen zu weiteren Traumata führen, die die Traumata der Flucht chronifizieren. Bär reflektiert die häufig zu beobachtende Rollenumkehr zwischen Kindern und Erwachsenen, in denen die Kinder zu Hoffnungsträgern der Familien werden; ihre schulischen Leistungen sollen den Selbstwert der Familien stärken. Sie zeigt auf, dass dieser Kontext zu einer schulischen Überangepasstheit und (vermeintlich) selbstständigen Entwicklung führen kann, was für Lehrkräfte als Ausdruck eines Traumas nicht leicht zu erkennen ist. Leichter zu erkennen sind Verhaltensweisen, die als Irritationen oder »Störung« in Erscheinung treten, so Bär. Sie resümiert, dass eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte darin besteht, dass es zur Übertragung der traumatischen Beziehung auf die Lehrperson kommen kann. An einem Fallbeispiel wird reflektiert, wie fragil der schulische Umgang mit einem Kind ist, das sich in einer (traumatischen) Krise nach der Flucht befindet. Der Beitrag schließt mit Möglichkeiten des schulischen Umgangs mit traumatisierten Kindern.
In dem Beitrag Interreligiöses Lernen im Unterricht der Grundschule berichtet Susanne von Braunmühl von Erfahrungen mit interreligiösem Lernen in Grundschulklassen. Zunächst wird grundgelegt, was unter interreligiösem Lernen zu verstehen ist und welche Bedeutung das Begegnungslernen in diesem Kontext hat. Im Anschluss daran werden drei unterschiedliche Beispiele aus der Praxis vorgestellt: 1. religiöse Feste, 2. religiöse Artefakte, 3. Besuch von Gotteshäusern. Ausgehend von den Fragen und Erfahrungen der Kinder wird dargestellt, wie interreligiöses Lernen stattfinden kann und wie Kinder sich gegenseitig über Bräuche, Rituale und Geschichten, die in ihrer Religion von Bedeutung sind, befragen und darüber berichten. Von Braunmühl arbeitet Ziele interreligiösen Lernens heraus und illustriert an einem Beispiel, wie dieser Prozess in der Praxis konkret aussehen kann.
Berthold, T. (2014): In erster Linie Kinder. Flüchtlingskinder in Deutschland. Köln: UNICEF.
Heckmann, F. (2015): Integration von Migranten. Einwanderung und neue Nationenbildung. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Karakaşoğlu, Y./Mecheril, P. (2019): Pädagogisches Können. Grundsätzliche Überlegungen zu LehrerInnenbildung in der Migrationsgesellschaft (17–33). In: Cerny, D./ Oberlechner, M. (Eds.): Schule – Gesellschaft – Migration. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich.
King, R./Lulle, A. (2016): Research on Migration: Facing Realities and Maximizing Opportunities. A Policy Review. European Commission, 68. https://www.researchgate.net/publication/299387596[Zugriff: 20.01.2018].
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft e. V. (2020): Lehrkräftebildung für die Schule der Vielfalt. Eine Handreichung des Netzwerks Stark durch Diversität.
World Vision Deutschland (2016): Angekommen in Deutschland. Wenn geflüchtete Kinder erzählen. Friedrichsdorf: World Vision.
1Im Mittelpunkt des dreijährigen Projektes (2016–2019), das vom Stifterverband gemeinsam mit der Schöpflin- und der Mercatorstiftung finanziert wurde, standen die Vernetzung und das gemeinsame Lernen universitärer Projekte, die zum Thema ›Migration in der Lehrerbildung‹ Projektideen entwickelt haben.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.