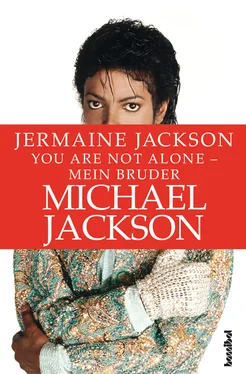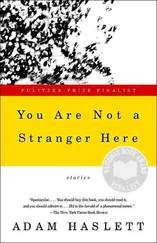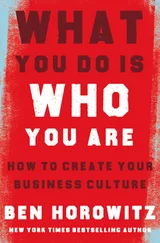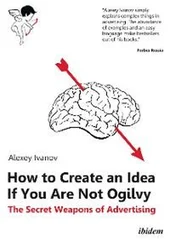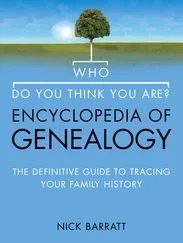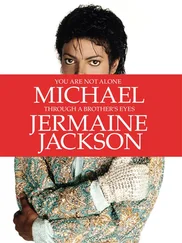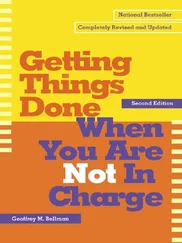1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 Vorn führte ein kurzer Gartenweg vom Bürgersteig über den Rasen zu einer schwarzen, soliden Tür, die, wenn man sie hart zuschlug, das ganze Haus erzittern ließ. Dahinter lag das Wohnzimmer, in dem unter anderem das braune Sofabett stand, auf dem die Mädchen schliefen; die Küche und der Hauswirtschaftsraum befanden sich zur Linken. Geradeaus führte ein kleiner Flur, etwa zwei Schritte lang, rechts zum Jungenzimmer und links zum Elternschlafzimmer, neben dem sich auch das Badezimmer befand.
Die Jackson Street lag in einem ruhigen Viertel, das im Süden von der Schnellstraße Interstate 80 und im Norden von einer Bahnlinie begrenzt wurde. Der Weg zu unserem Haus war leicht zu beschreiben, weil es direkt neben der Theodore Roosevelt High School und einem Sportplatz lag. Der Maschendrahtzaun, der das Sportgelände einfasste, bildete das Ende der Sackgasse der 23. Avenue und bot einen freien Blick auf die Laufstrecke zur Linken und das Baseballfeld mit den Tribünen auf der anderen Seite zur Rechten. Joseph meinte immer, wir könnten uns glücklich schätzen, dass uns das Haus gehörte. Das war nicht bei allen in unserer Nachbarschaft so. Deshalb betrachteten wir uns auch nie als „arm“, denn die Leute in der Delaney-Siedlung – auf der anderen Seite der Schule – wohnten zur Miete in den Sozialbauten, die wir von unserem Grundstück aus sehen konnten. „Es gibt immer jemanden, der übler dran ist, egal, wie schlecht die Lage gerade erscheinen mag“, hieß es immer. Man konnte unsere Situation von daher wohl so beschreiben: Wir besaßen zwar nicht genug Geld, um neue Sachen zu kaufen, aber wir kamen irgendwie zurecht.
Mutter lernte, wie sie Lebensmittel lange einlagern konnte: Eine Kühltruhe war in der schwarzen Community wichtiger als ein Auto oder ein Fernseher. Es wurden große Portionen gekocht, eingefroren, wieder aufgetaut, gegessen. Oft kam immer wieder das Gleiche auf den Tisch: Pinto-Bohnen und Pinto-Suppe, Hühnchen, Hühnchen und noch mal Hühnchen, Eier-Sandwiches, Makrele mit Reis und so viel Spaghetti, dass ich heute noch keine Pasta mag. Aus Brausepulver machten wir uns Limonade. Wir bauten sogar selbst Gemüse an, denn Joseph hatte einen Schrebergarten in der Nähe und erntete Kartoffeln, Brechbohnen, Augenbohnen, Kohl, Rote Beete und Erdnüsse. Schon als kleine Kinder lernten wir, wie man säte und Stecklinge setzte, eine Reihe zog und darauf achtete, dass genug Abstand blieb, damit die Pflanzen gedeihen konnten. Wenn wir uns beschwerten, dass wir schmutzige Hände und Knie bekamen, und das taten wir oft, dann pflegte Joseph uns daran zu erinnern, dass er als Jugendlicher auf den Baumwollfeldern gearbeitet „und dabei jeden Tag dreihundert Pfund von dem Zeug gepflückt“ habe. Seiner Meinung nach war Mutter „die verdammt noch mal beste Köchin der ganzen Stadt“, und das Essen stand immer auf dem Tisch, wenn er zur Tür hereinkam. Sie halte das Haus perfekt in Ordnung, sagte er immer bewundernd. Alles war immer aufgeräumt und sauber. Deshalb sei sie, wie er meinte, die ideale Ehefrau.
Auch an Rebbie fand er in dieser Hinsicht nichts auszusetzen, denn sie übernahm schnell ebenfalls Hausfrauenpflichten – sie bereitete das Essen vor, kochte, machte sauber und achtete darauf, dass wir anderen unsere Aufgaben erledigten, wenn Mutter arbeitete. Rebbie war große Schwester und Kindermädchen in einer Person, und dementsprechend war sie streng, sanft, organisiert und kontrolliert. Meine stärkste Erinnerung an Rebbie ist, wie sie in der Küche steht und Kekse und kleine Kuchen für uns alle backt. Sie war außerdem das erste von uns Kindern, das „vielversprechende Ansätze“ zeigte, wie Joseph das nannte, als sie sich bei örtlichen Tanzwettbewerben anmeldete und gewann. Sie und Jackie traten manchmal auch als Paar an und räumten eine Reihe von Urkunden und Pokalen ab.
Mutter arbeitete unter der Woche, manchmal auch samstags oder in den Abendstunden, bei Sears an der Kasse. In diesem noblen Kaufhaus selbst einzukaufen, konnte sie sich nicht leisten. Und wenn sie es doch einmal tat, dann handelte es sich meist um Ratenkäufe, bei denen sie sich etwas mit einer Anzahlung sicherte und es dann erst später, wenn sie das Geld zusammenhatte, mit nach Hause nahm. Sears war für uns wie Harrods. Wir alle fanden es schrecklich, wenn wir sahen, wie Mutter Geld über den Tresen reichte und trotzdem mit leeren Händen nach Hause ging. Wir verstanden das einfach nicht. Für uns Kinder war das schwer, und wir beklagten uns häufig, Mutter hingegen nie. Sie biss sich weiter durch und vertraute auf Gott. Wenn sie einmal etwas Zeit hatte, dann las sie in der Bibel.
Mit zwei Jahren war sie an Kinderlähmung erkrankt und behielt davon eine Teillähmung zurück. Bis sie zehn war, hatte sie eine Beinschiene aus Holz tragen müssen. Ich weiß nicht viel darüber, wie schwer sie als Kind gelitten hat, aber sie wurde mehrfach operiert, versäumte viel Zeit in der Schule und behielt ein leichtes Humpeln zurück, weil eines ihrer Beine kürzer ist als das andere. Aber ich habe nie ein Wort der Klage von ihr gehört. Stattdessen pflegte sie zu sagen, dass sie dankbar sei, eine Krankheit überlebt zu haben, an der viele andere Menschen starben. Sie hatte davon geträumt, Schauspielerin zu werden, aber sie zeigte kein bisschen Verbitterung darüber, dass ihr das aufgrund der Erkrankung nicht mehr möglich war. Wegen der körperlichen Beeinträchtigungen wurde sie von anderen Kindern oft gehänselt, und daher war sie stets sehr unsicher und schüchtern. Bei einem der ersten Treffen mit Joseph, als die beiden eine Tanzveranstaltung besuchten und zu einem langsamen Lied schwoften, begann Mutter, damals neunzehn Jahre alt, zu zittern. „Was ist denn los, Katie?“, fragte Joseph.
„Alle starren uns an“, sagte sie und traute sich nicht einmal, den Kopf zu heben.
Er sah sich um und stellte fest, dass sie das einzige Paar auf der Tanzfläche waren. Andere Gäste zeigten auf sie und tuschelten hinter vorgehaltener Hand, vermutlich deswegen, weil Mutter ein kürzeres Bein hatte und deswegen einen Schuh mit einem Keil trug, um den Unterschied auszugleichen. Als Jugendliche hatte sie Partys und gesellschaftliche Anlässe gefürchtet, aber Joseph ignorierte die Blicke und sah die Sache positiv. „Wir haben jetzt doch richtig viel Platz, Katie“, sagte er. „Komm, wir tanzen weiter.“
Mutter war als Kind aus Alabama nach Indiana gekommen, weil Papa Prince sich um Arbeit in der Stahlindustrie bemühte. Sie hatte immer davon geträumt, eines Tages einen Musiker kennenzulernen, und Joseph, der Gitarre spielte, erfüllte diese Anforderung durchaus. Sie gingen ein Frühjahr und einen Sommer lang miteinander aus, bevor sie heirateten. Getroffen hatten sie sich auf der Straße – oder vielmehr, Mutter befand sich draußen auf der Straße, und Joseph saß im Haus am Fenster, als sie auf dem Fahrrad an ihm vorüberfuhr. Sie tauschten Blicke aus, und sie nahm noch eine Woche oder zwei dieselbe Strecke, bis Joseph sich endlich ein Herz fasste, nach draußen kam und sich vorstellte. Daraufhin verabredeten sie sich für ein erstes Treffen im Kino und später dann zu besagter Tanzveranstaltung. Katie Scruse, das Mädchen mit der goldenen Haut, das so schüchtern war, dass es sich nicht traute, anderen ins Gesicht zu sehen, verliebte sich in Joseph Jackson, den hageren, großmäuligen, charismatischen Arbeiter. Sie wurden im November 1949 von einem Friedensrichter getraut und kauften unser Elternhaus in Gary zum Preis von 8.500 Dollar. Einen Teil der Summe brachte Joseph durch seine Ersparnisse auf, den Rest lieh ihnen Mutters Stiefvater.
Aus den geplanten drei Kindern wurden vier, dann fünf und so weiter. Sie versuchten, das bisschen Geld, das Mutter verdiente, zu sparen, denn sie hoffte darauf, dass Joseph eines Tages ein zusätzliches Zimmer würde anbauen können, damit alle mehr Platz hätten. In meiner Kindheit lagen im Garten hinterm Haus einige Reihen Betonsteine aufgestapelt, die allein mit ihrer Gegenwart immer wieder mahnend daran erinnerten, dass meine Mutter gern ein größeres, besseres Haus gehabt hätte.
Читать дальше