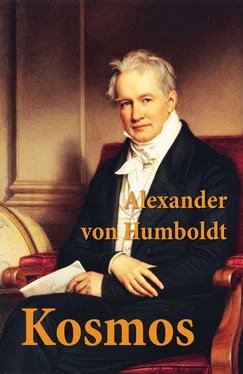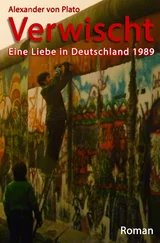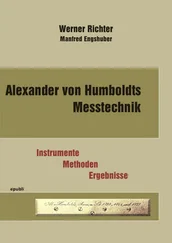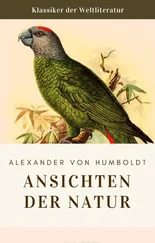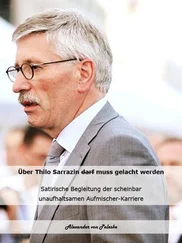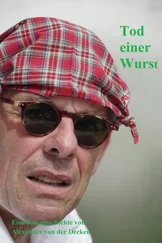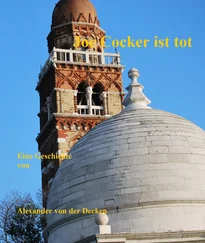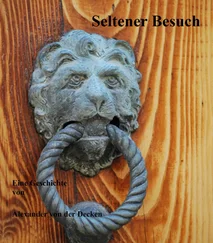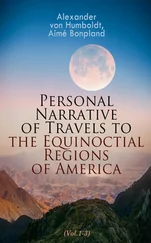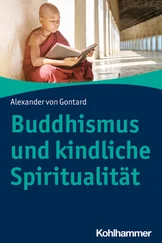In den untergeordneten Systemen der Trabanten oder Nebenplaneten spiegeln sich übrigens, ihrer Beziehung nach, zum Hauptplaneten und unter einander, alle Gravitations-Gesetze ab, welche in dem, die Sonne umkreisenden Hauptplaneten walten. Die 12 Monde des Saturn, Jupiter und der Erde bewegen sich alle, wie die Hauptplaneten, von Westen nach Osten, und in elliptischen Bahnen, die überaus wenig von Kreisbahnen abweichen. Nur der Erdmond und wahrscheinlich der erste und innerste Saturnstrabant (0,068) haben eine Excentricität, welche größer ist als die des Jupiter; bei dem von Bessel so genau beobachteten sechsten Saturnstrabanten (0,029) überwiegt sie die Excentricität der Erde. An der äußersten Grenze des Planetensystems, wo die Centralkraft der Sonne in 19 Erdweiten schon beträchtlich gemindert ist, zeigt das, freilich noch wenig ergründete System der Uranusmonde die auffallendsten Contraste. Statt daß alle anderen Monde, wie die Planetenbahnen, wenig gegen die Ekliptik geneigt sind und sich, die Saturnsringe (gleichsam verschmolzene oder ungetheilte Trabanten) nicht abgerechnet, von Westen nach Osten bewegen; stehen die Uranusmonde fast senkrecht auf der Ekliptik, bewegen sich aber, wie Sir John Herschel durch vieljährige Beobachtungen bestätigt hat, rückläufig von Osten nach Westen. Wenn Haupt-und Nebenplaneten sich durch Zusammenziehung der alten Sonnen-und Planeten-Atmosphären aus rotirenden Dunstringen gebildet haben; so muß in den Dunstringen, die um den Uranus kreisten, es sonderbare, uns unbekannte Verhältnisse der Retardation oder des Gegenstoßes gegeben haben, um genetisch eine solche der Rotation des Centralkörpers entgegengesetzte Richtung der Umlaufsbewegung in dem zweiten und vierten Uranus-Trabanten hervorzurufen.
Bei allen Nebenplaneten ist höchst wahrscheinlich die Rotations-Periode der Periode des Umlaufs um den Hauptplaneten gleich, so daß sie alle immerdar dem letzteren dieselbe Seite zuwenden. Ungleichheiten als Folge kleiner Veränderungen im Umlaufe verursachen indeß Schwankungen von 6 bis 8 Grad (eine scheinbare Libration) sowohl in Länge als in Breite. So sehen wir z. B. nach und nach vom Erdmonde mehr als die Hälfte seiner Oberfläche: bald etwas mehr vom östlichen und nördlichen, bald etwas mehr vom westlichen oder südlichen Mondrande. Durch die Libration Beer und Mädler a. a. O. § 185 S. 208 und § 347 S. 332; ders. Verf. phys. Kenntniß der himml. Körper S. 4 und 69 Tab. I. werden uns sichtbarer das Ringgebirge Malapert, welches bisweilen den Südpol des Mondes bedeckt, die arctische Landschaft um den Kraterberg Gioja, wie die große graue Ebene nahe dem Endymion, welche in Flächeninhalt das Mare Vaporum übertrifft. Ueberhaupt bleiben 3/ 7der Oberfläche gänzlich und, wenn nicht neue, unerwartet störende Mächte eindringen, auf immer unseren Blicken entzogen. Diese kosmischen Verhältnisse mahnen unwillkührlich an fast gleiche in der intellectuellen Welt, an die Ergebnisse des Denkens: wo in dem Gebiete der tiefen Forschung über die dunkele Werkstätte der Natur und die schaffende Urkraft es ebenfalls abgewandte, unerreichbar scheinende Regionen giebt, von denen sich seit Jahrtausenden dem Menschengeschlechte, von Zeit zu Zeit, bald in wahrem, bald in trügerischem Lichte erglimmend, ein schmaler Saum gezeigt hat.
Wir haben bisher betrachtet, als Producte Einer Wurfkraft und durch enge Bande der gegenseitigen Anziehung an einander gefesselt: die Hauptplaneten, ihre Trabanten und die Gewölbsformen concentrischer Ringe, die wenigstens einem der äußersten Planeten zugehören. Es bleibt uns noch übrig unter den um die Sonne in eigenen Bahnen kreisenden und von ihr erleuchteten Weltkörpern die ungezählte Schaar der Cometen zu nennen. Wenn man eine gleichmäßige Vertheilung ihrer Bahnen, die Grenze ihrer Perihelien (Sonnennähen), und die Möglichkeit ihres Unsichtbarbleibens für die Erdbewohner nach den Regeln der Wahrscheinlichkeits-Rechnung abwägt; so findet man eine Zahl von Myriaden, über welche die Einbildungskraft erstaunt. Schon Kepler sagt mit der ihm eigenen Lebendigkeit des Ausdrucks: es gebe in den Welträumen mehr Cometen als Fische in den Tiefen des Oceans. Indeß sind der berechneten Bahnen kaum noch 150: wenn die Zahl der Cometen, über deren Erscheinung und Lauf durch bekannte Sternbilder man mehr oder minder rohe Andeutungen hat, auf sechs-oder siebenhundert geschätzt werden kann. Während die sogenannten classischen Völker des Occidents, Griechen und Römer, wohl bisweilen den Ort angeben, wo ein Comet zuerst am Himmel gesehen ward: nie etwas über seine scheinbare Bahn; so bietet die reiche Litteratur der naturbeobachtenden, alles aufzeichnenden Chinesen umständliche Notizen über die Sternbilder dar, welche jeglicher Comet durchlief. Solche Notizen reichen bis mehr denn fünf Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung hinauf, und viele derselben werden noch heute Die vier ältesten Cometen, deren Bahn hat berechnet werden können, und zwar nach chinesischen Beobachtungen, sind die von 240 (unter Gordian III), 539 (unter Justinian), 565 und 837. Während daß dieser letzte Comet, der nach du Séjour 24 Stunden lang weniger als 500000 Meilen von der Erde entfernt war, Ludwig den Frommen dermaßen erschreckte, daß er durch Stiftung von Klöstern einer drohenden Gefahr zu entgehen hoffte; verfolgten die chinesischen Astronomen ganz wissenschaftlich die Bahn des Gestirns: dessen 60° langer Schweif bald einfach, bald getheilt erschien. Der erste Comet, welcher nach europäischen Beobachtungen allein hat berechnet werden können, ist der von 1456 (der Halley’sche: in der Erscheinung, welche man lange, aber mit Unrecht, für die erste, sicher bestimmte, gehalten hat). Arago im Annuaire pour l’an 1836 p. 204. Vergl. auch unten Anm. 55. von den Astronomen benutzt.
Von allen planetarischen Weltkörpern erfüllen die Cometen, bei der kleinsten Masse (nach einzelnen bisherigen Erfahrungen wahrscheinlich weit unter 1/ 5000der Erdmasse), mit ihren oft viele Millionen Meilen langen und weit ausgebreiteten Schweifen den größten Raum. Der lichtreflectirende Dunstkegel, den sie ausstrahlen, ist bisweilen (1680 und 1811) so lang gefunden worden als die Entfernung der Erde von der Sonne: eine Linie, welche zwei Planetenbahnen, die der Venus und des Merkur, schneidet. Es ist selbst wahrscheinlich, daß in den Jahren 1819 und 1823 unsre Atmosphäre mit dem Dunst der Cometenschweife gemischt war.
Die Cometen selbst zeigen so mannigfaltige Gestalten, oft mehr dem Individuum als der Art angehörend, daß die Beschreibung einer dieser reisenden Lichtwolken (so nannten sie schon Xenophanes und Theon von Alexandrien, der Zeitgenosse des Pappus) nur mit Vorsicht auf eine andere angewendet werden kann. Die schwächsten telescopischen Cometen sind meist ohne sichtbaren Schweif, und gleichen den Herschelschen Nebelsternen . Sie bilden rundliche, matt schimmernde Nebel, mit concentrirterem Lichte gegen die Mitte. Das ist der einfachste Typus: aber darum eben so wenig ein rudimentärer Typus als der eines durch Verdampfung erschöpften, alternden Weltkörpers. In den größeren Cometen unterscheidet man den Kopf oder sogenannten Kern , und einen einfachen oder vielfachen Schweif , den die chinesischen Astronomen sehr charakteristisch den Besen (sui) nennen. Der Kern hat der Regel nach keine bestimmte Begrenzung, ob er gleich in seltenen Fällen wie ein Stern erster und zweiter Größe, ja bei den großen Cometen von 1402, 1532, 1577, 1744 und 1843 selbst am Tage bei hellem Sonnenschein Arago im Ann. pour 1832 p. 209–211. So wie bei hellem Sonnenschein der Schweif des Cometen von 1402 gesehen wurde, sind auch vom letzten großen Cometen von 1843 Kern und Schweif am 28 Februar in Nordamerika (laut J. G. Clarke zu Portland im Staate Maine) zwischen 1 und 3 Uhr Nachmittags sichtbar gewesen. Man konnte Abstände des sehr dichten Kerns vom Sonnenrande mit vieler Genauigkeit messen. Kern und Schweif erschienen wie ein sehr reines, weißes Gewölk; nur zwischen dem Schweif und dem Kern war eine dunklere Stelle. Silliman’s Amer. Journ. of Science and Arts Vol. XLV. 1843 p. 229 ( Schum. astr. Nachr. 1843 No. 491 S. 175)., ist leuchtend gesehen worden. Dieser letztere Umstand zeugt demnach bei einzelnen Individuen für eine dichtere, intensiver Licht-Reflexion fähige Masse . Auch erschienen in Herschel’s großen Telescopen nur zwei Cometen, der in Sicilien entdeckte von 1807 wie der schöne von 1811, als wohlbegrenzte Scheiben Philos. Transact. for 1808 P. II. p. 155 und for 1812 P. I. p. 118. Die von Herschel gefundenen Durchmesser der Kerne waren 538 und 428 engl. Meilen. Für die Dimension der Cometen von 1798 und 1805 s. Arago im Annuaire pour 1832 p. 203.: die eine unter einem Winkel von 1”, die andere von 0”,77: woraus sich der wirkliche Durchmesser von 134 und 107 Meilen ergeben würde. Die minder bestimmt umgrenzten Kerne der Cometen von 1798 und 1805 gaben gar nur 6 bis 7 Meilen Durchmesser. Bei mehreren genau untersuchten Cometen, besonders bei dem eben genannten und so lange gesehenen von 1811, war der Kern und die neblige Hülle, welche ihn umgab, durch einen dunkleren Raum vom Schweife gänzlich getrennt. Die Intensität des Lichtes im Kerne der Cometen ist nicht gleichmäßig bis in das Centrum zunehmend; stark leuchtende Zonen sind mehrfach durch concentrische Nebelhüllen getrennt. Die Schweife haben sich gezeigt bald einfach, bald doppelt: doch dies selten, und (1807 und 1843) von sehr verschiedener Länge der beiden Zweige; einmal sechsfach, 1744 (bei 60° Oeffnung); gerade oder gekrümmt: sei es zu beiden Seiten, nach außen (1811), oder convex gegen die Seite hin (1618), wohin der Comet sich bewegt; auch wohl gar flammenartig geschwungen. Sie sind, wie (nach Eduard Biot) die chinesischen Astronomen schon im Jahr 837 bemerkten, in Europa aber Fracastoro und Peter Apian erst im sechzehnten Jahrhunderte auf eine bestimmtere Weise verkündigten, stets von der Sonne dergestalt abgewandt, daß die verlängerte Achse durch das Centrum der Sonne geht. Man kann die Ausströmungen als conoidische Hüllen von dickerer oder dünnerer Wandung betrachten: eine Ansicht, durch welche sehr auffallende optische Erscheinungen mit Leichtigkeit erklärt werden.
Читать дальше