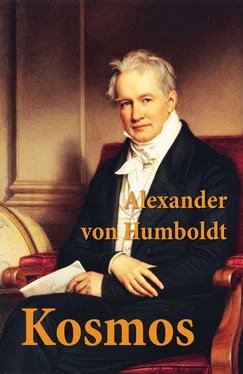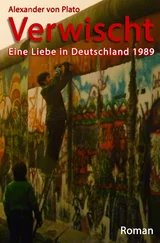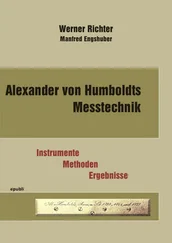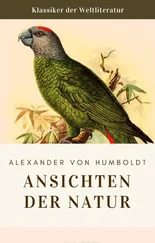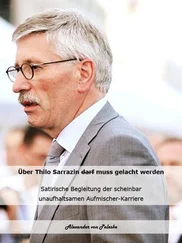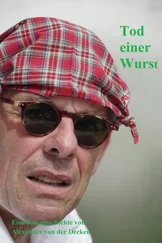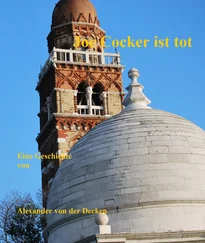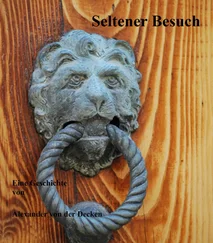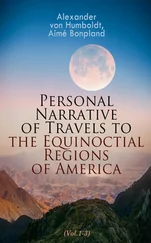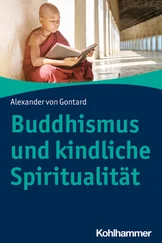Die Welt der Gestaltungen wird in dieser Aufzählung räumlicher Verhältnisse geschildert als etwas thatsächliches, als ein Daseiendes in der Natur: nicht als Gegenstand intellectueller Anschauung, innerer, ursachlich ergründeter Verkettung. Das Planetensystem in seinen Verhältnissen von absoluter Größe und relativer Achsenstellung, von Dichtigkeit, Rotationszeit und verschiedenen Graden der Excentricität der Bahnen hat für uns nicht mehr Naturnothwendiges als das Maaß der Vertheilung von Wasser und Land auf unserem Erdkörper, als der Umriß der Continente oder die Höhe der Bergketten. Kein allgemeines Gesetz ist in dieser Hinsicht in den Himmelsräumen oder in den Unebenheiten der Erdrinde aufzufinden. Es sind Thatsachen der Natur, hervorgegangen aus dem Conflict vielfacher, einst unter unbekannten Bedingungen wirkender Kräfte. Zufällig aber erscheint dem Menschen in der Planetenbildung, was er nicht genetisch zu erklären vermag. Haben sich die Planeten aus einzelnen um die Sonne kreisenden Ringen dunstförmiger Stoffe gebildet; so können die verschiedene Dicke, die ungleichförmige Dichtigkeit, die Temperatur und die electromagnetische Spannung dieser Ringe zu den verschiedensten Gestaltungen der geballten Materie, wie das Maaß der Wurfgeschwindigkeit und kleine Abänderungen in der Richtung des Wurfes zu den mannigfaltigsten Formen und Neigungen der elliptischen Bahnen Anlaß gegeben haben. Massen-Anziehungen und Gravitationsgesetze haben gewiß hier, wie in den geognostischen Verhältnissen der Continental-Erhebungen, gewirkt; aber aus der gegenwärtigen Form der Dinge ist nicht auf die ganze Reihe der Zustände zu schließen, welche sie bis zu ihrer Entstehung durchlaufen haben. Selbst das sogenannte Gesetz der Abstände der Planeten von der Sonne: die Progression, aus deren fehlendem Gliede schon Kepler die Existenz eines die Lücke ausfüllenden Planeten zwischen Mars und Jupiter ahndete; ist als numerisch ungenau für die Distanzen zwischen Merkur, Venus und Erde, und, wegen des supponirten ersten Gliedes, als gegen die Begriffe einer Reihe streitend befunden worden.
Die eilf bisher entdeckten, um unsere Sonne kreisenden Hauptplaneten finden sich gewiß von 14, wahrscheinlich von 18 Nebenplaneten (Monden, Satelliten) umgeben. Die Hauptplaneten sind also wiederum Centralkörper für untergeordnete Systeme. Wir erkennen hier in dem Weltbau gleichsam denselben Gestaltungs-Proceß, den uns so oft die Entfaltung des organischen Lebens, bei vielfach zusammengesetzten Thier-und Pflanzengruppen, in der typischen Formwiederholung untergeordneter Sphären zeigt. Die Nebenplaneten oder Monde werden häufiger in der äußeren Region des Planetensystems, jenseits der in sich verschlungenen Bahnen der sogenannten kleinen Planeten. Diesseits sind alle Hauptplaneten mondlos, die einzige Erde abgerechnet: deren Satellit verhältnißmäßig sehr groß ist, da sein Durchmesser den vierten Theil des Erd-Durchmessers ausmacht, während daß der größte aller bekannten Monde, der sechste der Saturnstrabanten, vielleicht 1/ 17;; und der größte aller Jupiterstrabanten, der dritte, dem Durchmesser nach, nur 1/ 26ihres Hauptplaneten oder Centralkörpers sind. Die mondreichsten Planeten findet man unter den fernsten: welche zugleich die größern, die sehr undichten und sehr abgeplatteten sind. Nach den neuesten Messungen von Mädler hat Uranus die stärkste aller planetarischen Abplattungen, 1/ 9,92. Bei der Erde und ihrem Monde, deren mittlere Entfernung von einander 51800 geographische Meilen beträgt, ist die Differenz Wenn der Halbmesser des Mondes nach Burckhardt’s Bestimmung 0,2725 und sein Volum 1/ 49,09ist, so ergiebt sich seine Dichtigkeit 0,5596, nahe 5/ 9. Vergl. auch Wilh. Beer und H. Mädler, der Mond S. 2 und 10, wie Mädler’s Astr. S. 157. Der körperliche Inhalt des Mondes ist nach Hansen nahe an 1/ 54(nach Mädler 1/ 49,6) des körperlichen Inhalts der Erde, seine Masse 1/ 87,73der Masse der Erde. Bei dem größten aller Jupiterstrabanten, dem dritten, sind die Verhältnisse zum Hauptplaneten im Volum 1/ 15370, in der Masse 1/ 11300. Ueber die Abplattung des Uranus s. Schum. astron. Nachr. 1844 No. 493. der Massen und der Durchmesser beider Weltkörper weit geringer, als wir sie sonst bei Haupt-und Nebenplaneten und Körpern verschiedener Ordnung im Sonnensysteme anzutreffen gewohnt sind. Während die Dichtigkeit des Erdtrabanten 5/ 9geringer als die der Erde selbst ist; scheint, falls man den Bestimmungen der Größen und Massen hinlänglich trauen darf, unter den Monden, welche den Jupiter begleiten, der zweite dichter als der Hauptplanet zu sein.
Von den 14 Monden, deren Verhältnisse mit einiger Gewißheit ergründet worden sind, bietet das System der sieben Saturnstrabanten die Beispiele des beträchtlichsten Contrastes in der absoluten Größe und in den Abständen von dem Hauptplaneten dar. Der sechste Saturns-Satellit ist wahrscheinlich nicht viel kleiner als Mars, während unser Erdmond genau nur den halben Durchmesser dieses Planeten hat. Am nächsten steht, dem Volum nach, den beiden äußersten (dem sechsten und siebenten) Saturnstrabanten der dritte und hellste unter den Jupitersmonden. Dagegen gehören die durch das 40füßige Telescop im Jahr 1789 von Wilhelm Herschel entdeckten, von John Herschel am Vorgebirge der guten Hoffnung, von Vico zu Rom und von Lamont zu München wiedergesehenen zwei innersten Saturnstrabanten, vielleicht neben den so fernen Uranusmonden, zu den kleinsten und nur unter besonders günstigen Umständen in den mächtigsten Fernröhren sichtbaren Weltkörpern unseres Sonnensystems. Alle Bestimmungen der wahren Durchmesser der Satelliten, ihre Herleitung aus der Messung der scheinbaren Größe kleiner Scheiben sind vielen optischen Schwierigkeiten unterworfen; und die rechnende Astronomie, welche die Bewegungen der Himmelskörper, wie sie sich uns von unserm irdischen Standpunkte aus darstellen werden, numerisch vorherbestimmt, ist allein um Bewegung und Masse, wenig aber um die Volume bekümmert.
Der absolute Abstand eines Mondes von seinem Hauptplaneten ist am größten in dem äußersten oder siebenten Saturnstrabanten. Seine Entfernung vom Saturn beträgt über eine halbe Million geographischer Meilen, zehnmal so viel als die Entfernung unseres Mondes von der Erde. Bei dem Jupiter ist der Abstand des äußersten (vierten) Trabanten nur 260000 Meilen; bei dem Uranus aber, falls der sechste Trabant wirklich vorhanden ist, erreicht er 340000 Meilen. Vergleicht man in jedem dieser untergeordneten Systeme das Volum des Hauptplaneten mit der Entfernung der äußersten Bahn, in welcher sich ein Mond gebildet hat, so erscheinen ganz andere numerische Verhältnisse. In Halbmessern des Hauptplaneten ausgedrückt, sind die Distanzen der letzten Trabanten bei Uranus, Saturn und Jupiter wie 91, 64 und 27. Der äußerste Saturnstrabant erscheint dann nur um ein Geringes ( 1/ 15) vom Centrum des Saturn entfernter als unser Mond von der Erde. Der einem Hauptplaneten nächste Trabant ist zweifelsohne der erste oder innerste des Saturn, welcher dazu noch das einzige Beispiel eines Umlaufes von weniger als 24 Stunden darbietet. Seine Entfernung vom Centrum des Hauptplaneten beträgt nach Mädler und Wilhelm Beer, in Halbmessern des Saturn ausgedrückt, 2,47; in Meilen 20022. Der Abstand von der Oberfläche des Hauptplaneten kann daher nur 11870, der Abstand von dem äußersten Rande des Ringes nur 1229 Meilen betragen. Ein Reisender versinnlicht sich gern einen so kleinen Raum, indem er an den Ausspruch eines kühnen Seemannes, Capitän Beechey, erinnert, der erzählt, daß er in drei Jahren 18200 geographische Meilen zurückgelegt habe. Wenn man nicht die absoluten Entfernungen, sondern die Halbmesser der Hauptplaneten zum Maaße anwendet; so findet man, daß selbst der erste oder nächste Jupitersmond, welcher dem Centrum des Planeten 6500 Meilen ferner als der Mond der Erde liegt, von dem Centrum seines Hauptplaneten nur um 6 Jupiters-Halbmesser absteht, während der Erdmond volle 60⅓ Erd-Halbmesser von uns entfernt ist.
Читать дальше