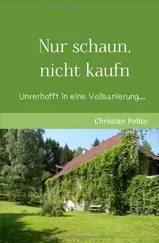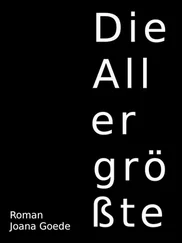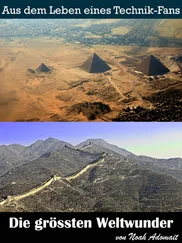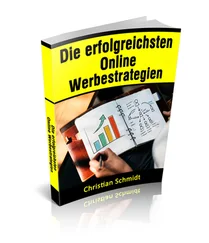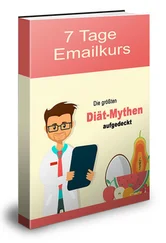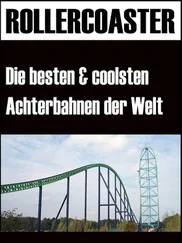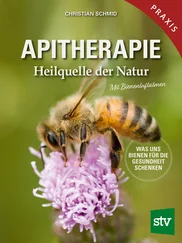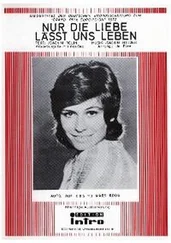Das Ei machte sich in unserer Sprache noch auf andere Art breit als mit dem Henne-Ei-Problem, dem Ei des Kolumbus und dem Osterei. Es hat es bis in die Sprache der Geometrie geschafft: Ein Oval , benannt nach einem von lateinisch ōvum «Ei» abgeleiteten spätlateinischen Fremdwort, ist eine geschlossene Kurve zwischen Kreis und Ellipse. Die heute kaum mehr benutzte deutsche Bezeichnung dafür war Eirund. Eiform und eiförmig werden hingegen heute noch oft gebraucht. Die eierförmig gepressten Briketts nennen wir Eierbriketts . Die Eihandgranate Modell 17 wurde im Ersten Weltkrieg, Modell 39 im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Soldaten verwendet. Mit ihr konnte man dem Feind ein Ei legen «schaden». Die Redensart öpperem es Ei lege «jemandem zu schaden versuchen» kommt aber nicht von der Handgranate her, sondern vom Kuckuck, der seine Eier in fremde Nester legt. Sie ist in Schweizer Mundarten seit dem 19. Jahrhundert belegt; im ersten Band des «Idiotikons» von 1881 lesen wir: eim es Ei legge «zu schaden suchen».
Unter dem Titel «Ein dickes Ei» berichtet der «Blick» am 4. August 2017 in einem Artikel, dass FDP-Parteipräsidentin Gössi die Renten für Senioren im Ausland infrage stellt. Der Artikel schliesst mit der Bemerkung, Gössi habe «damit ihren möglichen Bundesräten ein nicht minder dickes Ei gelegt». Du dickes Ei oder ach du dickes Ei ist seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Ausruf der Überraschung oder des Ärgers. Ein frühes Beispiel finden wir in Wolf von Niebelschütz’ Roman «Der blaue Kammerherr» von 1949: «‹O du dickes Ei›, sagte er plötzlich, ‹o du ganz dickes Ei: der Türk ist König von Phrygien›.»
Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts meint sich um ungelegte Eier kümmern «sich um Dinge kümmern, die noch nicht spruchreif sind oder einen nichts angehen». Bereits Martin Luther nahm «sorgest für ungelegte eyer» in seine Sprichwörtersammlung auf und erklärte, das meine, «sich Sorge machen über Dinge, die kaum erst in einer entfernten Möglichkeit da sind und in ungewisser, zweifelhafter Ferne liegen». «Viel Wind um ungelegte Eier», titelt der «Weser-Kurier» vom 15. September 2015.
Ein Eiertanz war ursprünglich, wie uns ein Nachschlagewerk aus dem Jahr 1842 erklärt, ein Tanz, «welcher zwischen mehreren Reihen von Eyern, die auf den Boden der Schaubühne hingelegt worden, so ausgeführt wird, dass der Tänzer auf den Zehenspitzen zwischen diesen Eyern hindurch tanzt, ohne ein Ey zu berühren, vielweniger es zu zertreten». In übertragenem Sinn bezeichnen wir heute mit Eiertanz ein «sehr vorsichtiges, gewundenes Verhalten». Die «Neue Zürcher Zeitung» vom 6. Dezember 2011 titelt: «Eiertanz mit Ausländern».
Wer einen Eiertanz aufführt, eiert nicht, denn eiern meint «ungleichmässig rotieren oder wackelnd gehen». Das Wort kam im 20. Jahrhundert auf und wurde zuerst für ein Rad gebraucht, das nicht rund läuft, weil seine Felge zu einem Ei verformt ist. Neuerdings meint herumeiern auch «sich unklar äussern, sich unschlüssig zeigen, umherirren». In einem Artikel des «Tages-Anzeigers» vom 5. März 2013 sagt Politexperte Michael Hermann: «Man kann auch gemässigte Positionen vertreten, ohne herumzueiern.»
Im Schatz der Redensarten ist das Ei seit der Antike vertreten. Wir sagen auch in der deutschen Sprache zuweilen noch ab ovo , wenn wir «ganz von Anfang an» meinen, z. B. im Satz: Rollen wir die Sache doch mal ab ovo auf . Damit zitieren wir den römischen Dichter Horaz (65–8 v. Chr.), der den Ausdruck in seiner «De arte poetica» braucht.
Der römische Philosoph und Politiker Seneca (ca. 1–65) brauchte den Ausdruck hominem tam similem sibi quam ovo ovum ; auf ihn geht unsere Redensart gleichen wie ein Ei dem andern zurück. Bereits 1513 lesen wir beim Niederdeutsch schreibenden Schulmeister Anton Tunnicius: «Eier sint eieren gelyk» und 1586 braucht Johannes Weyer die Redensart in seinem Traktat gegen Gespenster und Zauberer, wenn er schreibt, viele Geschichten seien «als gleich als ein Ey dem andern / ein milch der andern».
Seit dem 16. Jahrhundert können wir jemanden wie ein rohes Ei behandeln bzw. anfassen «mit jemandem äusserst behutsam umgehen». Ein frühes Beispiel finden wir in Friedrich Petris «Der Teutschen Weissheit» von 1605: «Ein Kindbetterin muss man halten und schonen / wie ein roh Ey.» Im Jahr 1687 klagt Arnold Mengering, es gebe Gesellen, die man «wie ein roh Ey halten» müsse. Laut «20 Minuten» vom 17. Oktober 2008 klagte Günter Grass: «Reich-Ranicki wird wie ein rohes Ei behandelt.»
In der «Stuttgarter-Zeitung» vom 18. September 2012 schreibt Theresa Schäfer einen Artikel unter dem Titel «Herzogin Kate: Immer wie aus dem Ei gepellt». Wie aus dem Ei geschält bzw. gepellt , in der Mundart wi us em Ei derhäärchoo «sehr sorgfältig gekleidet, tadellos aussehend» ist seit dem 18. Jahrhundert belegt. In «Der Renommist» von 1761 schreibt Friedrich Wilhelm Zachariä: «Gehst du beständig so, wie aus dem Ey gescheelet.» Und in Adelungs «Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches» von 1774 lesen wir: «Er ist beständig, wie aus dem Ey geschälet, im gemeinen Leben sehr reinlich, zierlich, geputzt.»
Er isch win es ugschalets Ei sagte man in gewissen Schweizer Mundarten von empfindlichen Personen, und wer zimperlich und affektiert auftritt, geit wi uf Eier . Was ganz frisch ist, isch wi us em Ei , und ein unreifer Mensch ist chuum us em Ei gschlüffe oder het no d Eierschalen am Füdle: Dä mues mer nid cho regänte, dä het ja no d Eierschalen am Füdle . Im Roman «Der letzte Gefangene» von 1964 schreibt Heinz G. Konsalik: «Unser Küken mit den Eierschalen am Hintern!»
Selbstverständlich machen das Ei, seine Teile, die Eierprodukte und die Eierproduzenten und -verkäufer den grössten Teil des Eierwortschatzes aus, vom Bioei, Freilandei und Osterei , über Eierschale, Eiweiss bzw. Eiklar und Eigelb bzw. Eidotter , die Eierspeisen wie Eierteigwaren, Frischeierteigwaren und Eiercognac bis zum Eierhändler oder früher dem Eiermaa , der Eierfrou , dem Eierbueb oder Eiermeitschi . Im zweiten Band der Erzählung «Waldheimat» von Peter Rosegger (1843–1918) trägt ein Abschnitt den Titel «Als ich Eierbub gewesen». Eine der Geschichten, die man sich von Poppele, vom Burggeist vom Hohenkrähen, erzählt, heisst «Poppele und das Eierwiib». Sie beginnt mit den Worten «Drückende Hitze brütete über dem Hegau, als die Eierfrau von Rielasingen mit der schweren Krätze auf dem Rücken nach Engen zum Markt wanderte».
Das Huhn als Fleischlieferant
Wir behandeln zwar den grössten Teil der Haushühner wie den letzten Dreck, aber ihr Fleisch essen wir in Massen. Weltweit wurden 2018 über 91 Millionen Tonnen Geflügelfleisch verzehrt; in der Schweiz steht das Geflügelfleisch mit 12,5 kg pro Kopf im Jahr beim Fleischkonsum an zweiter Stelle. Schnell wachsende Hybrid-Masthühner mit viel Brustfleisch werden gezüchtet; die männlichen Küken sind unbrauchbar und werden vergast oder geschreddert, was in naher Zukunft verboten werden soll.
In den Hausväterbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts werden die Hühner hingegen gerühmt als Eier- und Fleischlieferanten. Die «Oeconomia ruralis» von 1645 führt sie mit folgenden Worten ein:
«Die Hüner sind einem Hausswirte sehr nützlich und nötig / derwegen man zu sagen pflegt / wer Eyer haben will / der muss der Hüner gatzen (gackern) leiden. Drumb muss ein Wirth viel gute Hüner haben / nit allein umb des woldäwlichen (gut verdaulichen) Fleisches willen / das man bissweilen in den Mahlzeitten brauchen kan / sondern auch umb der Eyer willen.»
Читать дальше