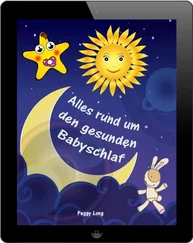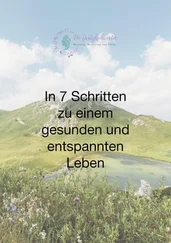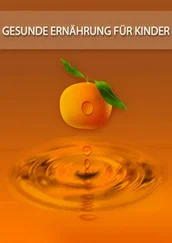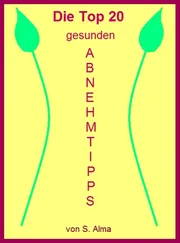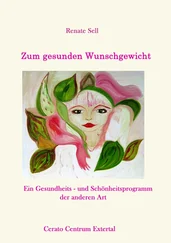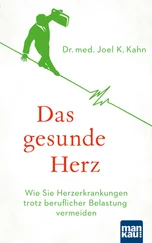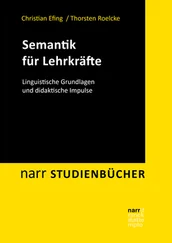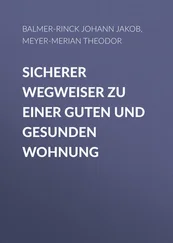2Sandmeier, A. (2010). Psychische Gesundheit und Lebensbewältigung vom Jugendalter ins frühe Erwachsenenalter. Der Einfluss von Beziehungserfahrungen auf die Entwicklung von Ich-Stärke. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Verfügbar unter http://opac.nebis.ch/ediss/20100908_003203825.pdf
3Affolter, B. (2019). Engagement und Beanspruchung von Lehrpersonen in der Phase des Berufseintritts: Die Bedeutung von Zielorientierungen, Selbstwirksamkeitserwartungen und Persönlichkeitsmerkmalen im JD-R Modell. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
»Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben.«
Oscar Wilde
Gesundheit und Pädagogik sind seit den Anfängen der institutionalisierten Volksschulbildung eng miteinander verbunden. Entsprechend hat die Auseinandersetzung von Wissenschaft und Praxis mit dem Thema der gesunden Schule eine lange Geschichte (Aregger & Lattmann, 2003). Diesbezüglich lässt sich feststellen, dass sich die Betrachtungsweisen zur Thematik stetig und teilweise auch ganz grundsätzlich verändert haben. Für das heutige Verständnis der Gesundheitsförderung in Schulen scheinen uns vor allem drei besondere Wendungen zentral.
Für einen ersten zentralen Perspektivenwechsel war die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1946 verantwortlich. Sie definierte Gesundheit als den »Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen« (WHO, 1946, S. 1). In dieser Definition wurde die bis zu jenem Zeitpunkt hauptsächlich im Fokus stehende körperliche Dimension durch psychische und soziale Aspekte von Gesundheit ergänzt. Gesundheit sollte zudem mehr umfassen, als nur »nicht krank« zu sein. Auf dieser erweiterten, positiven Bestimmung von Gesundheit konnten weitere Entwicklungen aufbauen. An der ersten Konferenz zur Gesundheitsförderung der WHO in Ottawa 1986 wurde das Ziel der Gesundheitsförderung erweitert (sog. Ottawa-Charta). In den Vordergrund wurde der »Prozess« gerückt, was dazu beitragen sollte, »allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen« (WHO, 1986, S. 1). Dadurch wurde die Gesundheitsförderung dynamisiert und Gesundheit nicht mehr länger nur als Zustand verstanden. Zudem wurde die Gesundheitsförderung mit dem Ziel der Selbstbestimmung stärker personalisiert, was nicht ohne den dringlichen Hinweis erfolgte, dass dabei auch das Umfeld und dessen Akteurinnen und Akteure in die Verantwortung einzubeziehen seien.
Einen zweiten prägenden Zugang eröffnete der salutogenetische Ansatz des amerikanisch-israelischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Antonovsky (1997) ging davon aus, dass Stressoren in unserem Leben omnipräsent sind. Die Grundsatzfrage, die es aus salutogenetischer Perspektive zu klären gilt, lautet deshalb: Wie können Menschen trotz Belastungen gesund bleiben bzw. ihre Gesundheit wiederherstellen? Mit diesem Zugang wird den Ressourcen der erfolgreichen Bewältigung bei der Erforschung und in der Förderung gesundheitsbezogener Aspekte besondere Beachtung geschenkt, ohne die Stressoren auszublenden.
Eine dritte bedeutsame Wende in der Betrachtung von Gesundheit lässt sich weniger auf theoretische Modelle als vielmehr auf empirische Befunde zurückführen. So zeigen neuere Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien, dass die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern in vielfacher Weise mit Schulqualität zusammenhängen (Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke & Baumert, 2008; Klusmann, Richter & Lüdtke, 2016). Diesen Befunden zufolge haben die Gesundheit und das Wohlbefinden von Lehrerinnen und Lehrern einen Einfluss auf das Wohlbefinden, die Leistungsmotivation und den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern. Gesunden Lehrkräften gelingt es besser, eine positive soziale Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen als ungesunden Lehrkräften. Sie gestalten einen besseren Unterricht und haben nachweislich einen positiven Einfluss auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Die Frage, was Lehrkräfte langfristig gesund und erfolgreich im Beruf hält, erhält deshalb unmittelbare Relevanz für die Bildungs- und Erziehungsqualität und den »Output« von Schulen, das heißt für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse muss die Gesundheitsförderung vom »Kopf auf die Füße gestellt« werden, wie es Paulus (2003) bereits vor längerer Zeit gefordert hatte.
Betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen ist somit nicht mehr ein »Exotenthema« oder »nice to have«, sondern bildet die Grundlage für Schulqualität. In Zeiten des Lehrkräftemangels erhält das Thema zusätzlich Dringlichkeit, denn Studien, wie beispielsweise jene von Brägger (2019), die sich auf die Situation in der Schweiz bezieht, zeigen, dass Lehrkräfte ihr Lehrdeputat reduzieren, um Belastungen zu minimieren. Lehrkräfte werden wegen Dienstunfähigkeit frühpensioniert (Gehrmann, 2013), und der Lehrberuf ist angesichts der negativen Schlagzeilen zu wenig attraktiv, um genügend neue Personen dafür zu gewinnen (Köller, Stuckert & Möller, 2019). Damit weitet sich der Blickwinkel auf das Thema der Förderung der Gesundheit von Lehrkräften und erhält höchste Relevanz und Aktualität für die Führung von Schulen, den Lehrberuf wie auch die Lehrerinnen und Lehrer selbst.
1.2 Zur Zielgruppe und zu den Ansprüchen des Buches
»Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen« ist als einführendes Lehrbuch konzipiert worden. Es richtet sich an verschiedene Zielgruppen: In erster Linie angesprochen werden sollen alle (zukünftigen) Lehrerinnen und Lehrer, die reflektiert mit ihren eigenen Erfahrungen mit beruflichen Belastungen umgehen möchten. Zweiter zentraler Adressat sind Schulleitungen, die das Ziel verfolgen, die Arbeitsbedingungen an ihrer Schule so zu gestalten, dass ihre Lehrkräfte den beruflichen Alltag gesund meistern und dadurch zur Qualität der Schule beitragen können. Drittens wird die Lehrerinnen- und Lehrerbildung adressiert, die über Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beratung sowie Forschung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung von Lehrkräften und Schulen leisten kann. Und viertens wendet sich das Buch an die Berufsverbände und die Bildungspolitik, die in der Thematik und ihrer öffentlichen Darstellung eine bedeutsame Rolle spielen. Wir richten uns in unseren Ausführungen auf das deutschsprachige Europa aus. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeben sind, werden so weit wie möglich berücksichtigt.
Mit dem Lehrbuch verfolgen wir den grundlegenden Anspruch, theoretische Modelle und forschungsbasierte Erkenntnisse transferorientiert aufzubereiten. Den forschungsbasierten Zugang halten wir gerade bei einem Thema für zentral, das stark von subjektiven Theorien geprägt ist. Denn wir sind überzeugt: Will man die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern systematisch fördern, braucht es tragfähige, gesicherte Informationen, die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema erarbeitet wurden und vom einzelnen Individuum und seinen Erfahrungen abstrahieren. Die Darstellung zentraler Begriffe und Modelle (  Kap. 2), der Besonderheiten des Arbeitskontexts von Lehrkräften (
Kap. 2), der Besonderheiten des Arbeitskontexts von Lehrkräften (  Kap. 3) und der jeweilige Stand der empirischen Forschung bilden deshalb in allen Kapiteln die zentralen Grundlagen der Ausführungen.
Kap. 3) und der jeweilige Stand der empirischen Forschung bilden deshalb in allen Kapiteln die zentralen Grundlagen der Ausführungen.
Damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den konkreten Alltag transferiert werden können, braucht es eine spezifische Aufbereitung. Das Lehrbuch strebt keinen umfassenden Überblick über alle vorliegenden Theorien und Forschungsergebnisse an, sondern nimmt eine bewusste Auswahl vor, um Orientierung für die Praxis zu bieten. Auf alternative Modelle und umfassende Darstellungen wird in den jeweiligen Kapiteln jedoch stets verwiesen. Die Auswahl der theoretischen Ansätze und empirischen Befunde basiert auf der systematischen Auseinandersetzung der Autorinnen und des Autors mit der Frage, was die zentralen Forschungserkenntnisse zur Thematik sind und welche Zugänge sich für die Rezeption am besten eignen.
Читать дальше
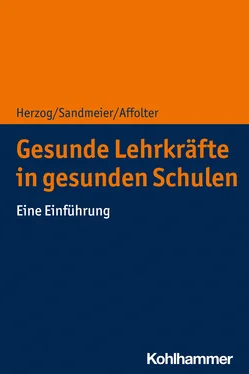
 Kap. 2), der Besonderheiten des Arbeitskontexts von Lehrkräften (
Kap. 2), der Besonderheiten des Arbeitskontexts von Lehrkräften (