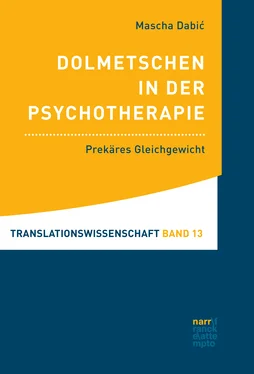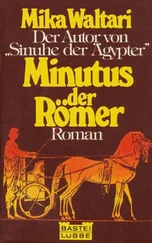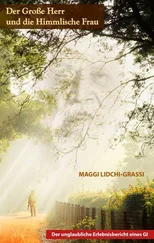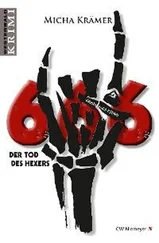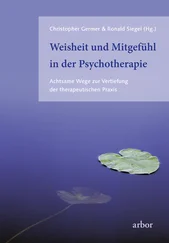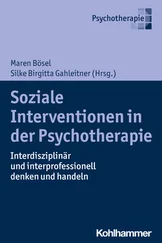Die Erklärung, die Freud schließlich für die Empörung gegen den Krieg liefert, ist von verblüffender Schlichtheit: „Ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, daß wir nicht anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen.“ (2007: 176). Mit „organischen Gründen“ meint er den Umstand, dass der Prozess der Kulturentwicklung zu psychischen Veränderungen führt, indem eine fortschreitende Verschiebung der Triebziele und Einschränkungen der Triebregungen stattfinden. Es komme zu einer Erstarkung des Intellekts, die wiederum zu einer stärkeren Beherrschung des Trieblebens führt, sowie zu einer Verinnerlichung der Aggressionsneigung. Weiter führt Freud aus:
Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. (…)
Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfluß dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes dürfen wir uns sagen: Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. (Freud 2007: 176f.)
Gegen den Krieg arbeiten, besser gesagt gegen die verheerenden psychischen, emotionalen und sozialen Folgen des Krieges arbeiten – das ist sicherlich mit ein Gesichtspunkt, unter dem die Arbeit von PsychotherapeutInnen und DolmetscherInnen im Rahmen der transkulturellen Psychotherapie mit Kriegs- und Folterüberlebenden zu betrachten ist.
2.8 Abschließende Bemerkungen
Die in diesem Kapitel angeführten Werke können lediglich eine Idee von der Vielfalt der Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur im Kontext der Psychoanalyse und der unterschiedlichen psychotherapeutischen Richtungen vermitteln. Der psychoanalytische Blick auf die Verortung des Individuums in der Kultur (bzw. in den Kulturen) und auf die interkulturelle Kommunikation kann für die Translationswissenschaft eine Bereicherung darstellen, zum einen auf Grund der Miteinbeziehung gesellschaftlicher Mechanismen und zum anderen auf Grund der Fokussierung auf das Individuum und seine ökonomischen, sozialen, kulturellen, intellektuellen und emotionalen Bedürfnisse.
Die Lektüre einschlägiger theoretischer Abhandlungen und praktischer Erfahrungsberichte legt den Schluss nahe, dass es in der konkreten Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern (und Kulturen) in erster Linie darauf ankommt, einen Zugang zum Eigenen (also auch zu den eigenen Vorurteilen) zu finden, um einen respektvollen Umgang mit dem „Fremden“ (welches durch die zunehmende Annäherung immer vertrauter und somit weniger fremd wird) zu ermöglichen. Für einen solchen Prozess sind Lernbereitschaft und Lernfähigkeit unabdingbar.
3 Trauma: individuelle und kollektive Auswirkungen
Das interkulturelle psychotherapeutische Setting, von dem in der vorliegenden Arbeit die Rede ist, bezieht sich auf die Behandlung kriegs- und foltertraumatisierter Menschen. Trauma als nachhaltig wirksame körperliche und/oder seelische Verletzung ist ein vielschichtiges Phänomen, das durch die sogenannte Flüchtlingskrise der letzten Jahre zunehmend an gesellschaftlicher Wahrnehmung und Brisanz gewinnt. Ich werde mich im Folgenden auf jene Aspekte beschränkten, die für DolmetscherInnen, die in der Psychotherapie mit kriegs- und foltertraumatisierten Menschen arbeiten, von Relevanz sein können.
Das folgende Zitat der Traumatherapeutin Michaela Huber soll ein Schlaglicht darauf werfen, was therapeutisches Arbeiten mit traumatisierten Menschen bewirken kann bzw. bewirken können soll:
Es gibt wohl keine intensivere Begegnung als die in der Therapie mit Menschen, die nach Erfahrungen, welche ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen haben, wieder versuchen, ins Leben zurückzufinden. Oder, wie es bei vielen früh und langjährig traumatisierten Frauen und einigen Männern der Fall ist, mit denen ich meistens arbeite: Die überhaupt zum ersten Mal entdecken, wie äußere Sicherheit sich anfühlen, wie Lebensfreude schmecken kann. Sie dabei zu begleiten, sich zu der Persönlichkeit zu entwickeln, die erst einmal gewaltsam blockiert oder zersplittert wurde, und die dann gereift und mit der Fähigkeit, nach innen beschützend und nach außen wehrhaft zu sein, ihr eigenes Potenzial entfalten kann – das ist eine große Freude. So herausfordernd und oft anstrengend diese Arbeit ist, sie verändert beide Beteiligten, und wenn es gelingt, bereichert sie und ist jeder Mühe wert. (Huber 2005: 18)
Hier ist die Rede von den „beiden Beteiligten“, Huber meint also die klassische Dyade (TherapeutIn und KlientIn), dennoch ist in diesem Zitat vieles enthalten, was DolmetscherInnen verinnerlichen oder begreifen sollten, um die therapeutische Haltung gegenüber den z.T. schwer traumatisierten KlientInnen erkennen und so weit mittragen zu können, wie es nötig ist, um die therapeutische Kommunikation zu ermöglichen. Das therapeutische Setting hat unter anderem die Funktion, ein Gefühl der Sicherheit zu evozieren – DolmetscherInnen sind an der Herstellung einer solchen Atmosphäre maßgeblich beteiligt, sowohl im Rahmen einer einzelnen Stunde als auch in der Kontinuität, als langfristige, wenn auch prekär beschäftigte MitarbeiterInnen in Einrichtungen für Behandlung von Kriegs- und Folterüberlebenden.
Auch wenn die Begriffe Trauma und davon abgeleitete Adjektive („traumatisiert“, „traumatisch“) mitunter inflationär oder gedankenlos verwendet werden1 , so ist Trauma keineswegs ein neumodisches Phänomen, sondern reicht in die Antike zurück (Smolenski 2006: 7f.).
Smolenski bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der Traumatherapie und erwähnt u.a. entsprechende Schilderungen bei Homer über Achilles, die auf eine psychotraumatische Symptomatik hinweisen. Im 20. Jahrhundert waren es insbesondere die beiden Weltkriege, die zu massenhaften Traumatisierungen führten. Nach dem 2. Weltkrieg war das Sprechen über die traumatischen Erlebnisse deutscher Soldaten und der Zivilbevölkerung jedoch zunächst noch tabuisiert, und erst als die zahlreich auftretenden posttraumatische Belastungsstörungen bei Rückkehrern aus dem Vietnam-Krieg auch medial Beachtung fanden, gab es neue Entwicklungsimpulse für die Traumabehandlung. Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung fand 1980 Eingang in das „Diagnostic and statistical manual of mental disorders“, und 1992 wurde dieses Krankheitsbild in die ICD-10 („International classification of diseases, injuries and causes of death“) der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen (vgl. Smolenski 2006: 15).
Darin wird Trauma folgendermaßen definiert:
(…) ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (z. B. Naturkatastrophe oder menschlich verursachtes schweres Unheil – man-made disaster – Kampfeinsatz, schwerer Unfall, Beobachtung des gewaltsamen Todes Anderer oder Opfersein von Folter, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen). (ICD-Code, Stand 25.5.2017)
Die Rede ist also von einem Ereignis, bei dem die natürlichen Schutzmechanismen versagen, weil es keine Möglichkeit gibt, sich den äußeren (gewaltsamen) Einwirkungen zu entziehen. Der Mensch erlebt Hilflosigkeit und Ohnmacht, mitunter auch Scham, in einem extremen Ausmaß. Wie es in der Definition heißt, würden diese Ereignisse „bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die KlientInnen nicht im eigentlichen Sinne „krank“ sind, jedenfalls nicht notwendigerweise, sondern von krankmachenden Ereignissen und Erlebnissen so schwer gezeichnet sind, dass die Symptome über das Ereignis hinaus sich immer wieder bemerkbar machen können. Dabei ist von Menschen verursachtes Unheil psychisch schwerer zu bewältigen als Naturkatastrophen, weil sich im ersten Fall stets Fragen von Schuld, Unrecht, Gerechtigkeit oder Rache stellen, ebenso wie die tendenziell mit Selbstvorwürfen behaftete Frage, ob es möglich gewesen wäre, das traumatische Ereignis zu vermeiden (wenn man sich rechtzeitig zur Flucht entschlossen hätte, wenn man dies oder jenes getan oder unterlassen hätte).
Читать дальше