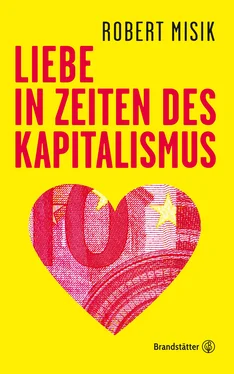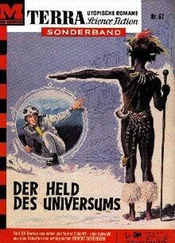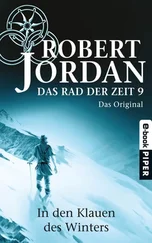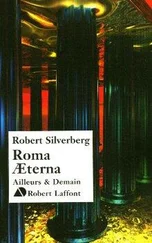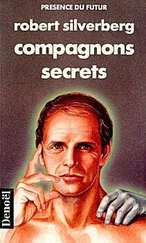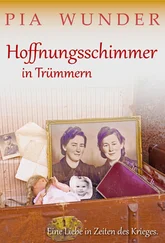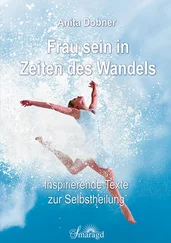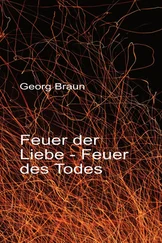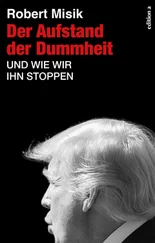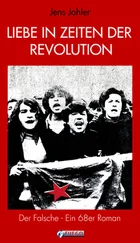Robert Misik - Liebe in Zeiten des Kapitalismus
Здесь есть возможность читать онлайн «Robert Misik - Liebe in Zeiten des Kapitalismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Liebe in Zeiten des Kapitalismus
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Liebe in Zeiten des Kapitalismus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Liebe in Zeiten des Kapitalismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Robert Misik, der renommierte Sachbuchautor, macht sich Gedanken zu unserer Gegenwart. Anhand zehn exemplarischer Begriffe, die Zeitgeist und Verfasstheit unserer Gesellschaft treffend skizzieren, geht er der Frage nach, welchen Paradigmen wir unsere Leben unterwerfen.
Liebe in Zeiten des Kapitalismus — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Liebe in Zeiten des Kapitalismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Auf dem Rücken des Begriffs der „Chancengerechtigkeit“ schlich sich das marktliberale Leistungscredo tief in die sozialdemokratischen Spitzenetagen hinein. Er ist von der marktliberalen Selbstillusion freier und gleicher Märkte, auf denen alle Akteure die gleichen Chancen haben sollen, zu Gewinnern (und damit auch zu Verlierern) werden zu können, praktisch ununterscheidbar geworden. Aus dieser Perspektive ist kaum mehr zu argumentieren, wie Ungleichheiten noch korrigiert werden könnten, wenn sie einmal hergestellt sind (und warum dies geschehen sollte), sieht man von zwei Einschränkungen ab: Jeder soll auch in modernen Marktökonomien überleben können und Ungleichheiten sollen sich über die Genealogie der Generationen, wenn möglich, nicht zu neuen „Chancenungerechtigkeiten“ verfestigen. Eine Einschränkung, die sehr bald auch Giddens machen musste. Ohne Umverteilung würde „aus der Ungleichheit im Ergebnis der einen Generation die Ungleichheit der Chancen der nächsten“. Dies ist freilich alles, was vom alten Gleichheitsideal geblieben ist.
DIE GLEICHHEITist ein vertracktes Ding. Als Ideal führte sie in der linken Theoriegeschichte – wie jedes Ideal, das in Hinblick auf das Prinzip des historischen Materialismus unter immerwährendem Moralitätsverdacht steht – ein Leben im Schatten, im Nebel der Werte. Selbst Karl Marx hatte in seinen späten Tagen hochgradig gereizt reagiert, als die deutsche Sozialdemokratie in ihrem Gothaer Programm die Forderung nach „Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheiten“ erhob. „Anstatt der unbestimmten Schlussphrase“, bekrittelte der Stammvater der modernen Linken verärgert aus seinem Londoner Exil, „war zu sagen, dass mit der Abschaffung der Klassenunterschiede von selbst alle aus ihnen entspringenden sozialen und politischen Ungleichheiten verschwinden“.
Tatsächlich ist das Ideal der Gleichheit älter als jede sozialistische Theorie und nährte sich aus vielerlei Traditionen. Schon mit dem Entstehen der modernen Staatstheorie wurde die Frage aufgeworfen, ob reine rechtliche, formale Gleichheit vor dem Gesetz wirklich reicht, oder ob der Zusammenhalt eines Gemeinwesens nicht die relative soziale Gleichheit seiner Bürger voraussetze. „Seiner Natur nach strebt der Wille des Einzelnen nach Vorrechten, der Allgemeinwille dagegen nach Gleichheit“, wusste Rousseau in seinem „Contrat social“, und auch, „dass den Menschen der gesellschaftliche Zustand nur so lange vorteilhaft ist, als jeder etwas und keiner zu viel hat“.
Einen immerwährenden Impuls erfuhr das Gleichheitsideal auch durch die „plebejische Kultur“, also das, was man die Lebenspraxis oder die Lebenswelten der Unterklassen nennen könnte, die einerseits von Idealvorstellungen eines „gerechten Preises“ oder eines „angemessenen Lohnes“ bestimmt wurden, andererseits durch die Alltagserfahrungen von Handwerkern und Fabrikarbeitern. So war noch die fortschrittliche Fabrikorganisation, die individuelle Fertigkeiten entwertete und insofern die Arbeiter „immer gleicher“ machte, eine mächtige Verbündete der Gleichheitsvorstellungen. Auch in Gestalt eines mehr oder weniger diffusen „Gemeinschaftsgefühls“ war uns die Gleichheit bekannt. Derart zentral und peripher, anwesend und abwesend zugleich, politisch still repräsentiert und stumm vorausgesetzt, sind die Gleichheitshoffnungen der Mehrheiten nie vordergründig sichtbar gewesen und sie sind es heute weniger denn je. Und auch das kollektivistische Motiv des Gleichheitsideals und das Versprechen auf Befreiung des Individuums aus gesellschaftlichen und somit kollektiven Zwängen lagen immer in einem Spannungsverhältnis, wie es von Marx in der berühmten Formulierung des „Kommunistischen Manifests“ aufzulösen versucht wurde, wonach im Kommunismus „die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“.
So müssen die Gleichheitshoffnungen in ihrer oft paradoxen Gestalt gesehen werden. Schon die immer genervte Rechtfertigung der Ungleichheit als ökonomisch oder sozial nützlich durch die Ideologen des Konkurrenzprinzips verweist auf einen tief sedimentierten Begriff der Gleichheit. Auch der Egalitarismus selbst tritt oft nur auf subtile Art, sozusagen negativ auf: nicht als Forderung nach „mehr Gleichheit“, sondern als waches Sensorium für jedwede Gefährdungen der Gleichheit, die auch in Neid und Ressentiments ihren Ausdruck finden können. So mag zwar jeder das Bedürfnis nach Distinktion verspüren, ist gleichzeitig aber Adressat der Abgrenzungsbedürfnisse anderer, die dann aber „Überheblichkeit“ und „Arroganz“ heißen, auf die der Einzelne leicht allergisch reagiert.
KLAR IST JEDENFALLS:Auch unsere modernen Gesellschaften verfügen über stark wirksame Gerechtigkeitskulturen, doch die sind „so kompliziert wie das Leben selbst“, wie Angela Krebs formuliert. So kompliziert, dass, wenn die Rede auf Gerechtigkeitsideale kommt, eher Ahnungen referiert werden als gesicherte Sachverhalte. „Meiner Ansicht nach“, schreibt etwa Anne Phillips, „ist den Menschen die Frage der Gleichheit eher wichtiger denn unwichtiger geworden. Sie bestehen nachdrücklicher darauf, als Gleiche behandelt zu werden (‚Wieso glaubt er, etwas Besseres zu sein, als ich?‘; ‚Woher nimmt er das Recht, mir sagen zu wollen, was ich zu tun habe?‘), sind weniger bereit, eine untergeordnete Position zu akzeptieren.“ Die Feststellung, dass Ungleichheit einer besonderen Rechtfertigung bedarf, wohingegen dies für die Gleichheit nicht gilt, ist ohne Zweifel immer noch richtig und ein gewichtiges Indiz für die starke Verwurzelung eines die Gleichheit betonenden Gerechtigkeitsideals. Diesen Gedanken hatte auf eindringliche Weise der russisch-angloamerikanische Philosoph Isaiah Berlin entwickelt: „Die Behauptung ist, dass Gleichheit keiner Rechtfertigung bedarf. Wenn ich einen Kuchen besitze und es zehn Personen gibt, unter denen ich aufteilen will, dann entsteht nicht automatisch ein Rechtfertigungsbedarf, wenn ich jeder Person ein Zehntel des Kuchens zukommen lasse. Wenn ich jedoch von diesem Grundsatz der Gleichverteilung abrücke, wird von mir erwartet, besondere Gründe dafür anzugeben.“
In dieses Bild der Paradoxien fügt sich übrigens, dass ausgerechnet die Epoche „gleichmacherischer“ Massendemokratien die Ideologie des „Individualismus“ entwickelte, und just im Zeitalter kapitalistischer Uniformierung und Standardisierung die feinen Unterschiede zwischen den Massenexistenzen immerwährend betont werden. „Sprache, Kleider, Gebärden und Physiognomien gleichen sich an“, beobachtete Siegfried Kracauer schon in den Zwanzigerjahren in seinen berühmten Studien der modernen Angestelltenwelt. Es ist grotesk, dass ausgerechnet die kapitalistischen Funktionseliten, denen ihre Austauschbarkeit in Gestalt ihrer „Business-Suites“ auf den Leib geschrieben steht, gegen die „Gleichmacherei“ wettern.
Der Historiker Paul Nolte hat in einem bemerkenswerten Aufsatz die neuen Trennungen beschrieben – als „ein getreues Abbild der alten Klassengesellschaft, die wir verdrängt haben, ohne ihre Realität beseitigen zu können“. Neue, subtile Spaltungen tun sich auf. So habe der „private Konsum … eine größere Bedeutung für die Selbststilisierung des Einzelnen“ gewonnen, haben „Konsum und Lifestyle soziale Unterschiede nicht eingeebnet, sondern vergrößert“. Die Möglichkeiten, die etwa der technologische Fortschritt bietet, verringern gleichzeitig die Chancen derer, die – aus welchen Gründen immer – diese nicht wahrnehmen können. Die „Internet-Linie“ spaltet alle, die die neuen Technologien beherrschen, von jenen ab, die dies nicht tun. So spielen die Kategorien „Alter und Generation in den sozialen Verteilungskämpfen eine größere Rolle“. Bei der Rede über „Individualisierung“, „Risiko“ und „Optionen“ fällt selten auf, „dass die einen mehr Optionen haben, die anderen größere Risiken tragen“. Wenngleich sich, trotzdem sich die Schere zwischen Oben und Unten öffnet, durch den sozialen „Fahrstuhleffekt“ der allgemeine Lebensstandard erhöht haben mag, so wuchsen die Abstände und haben sich „neue, subtile Mechanismen der sozialen Differenzierung herausgebildet“. Völlig unbeachtet, so Nolte, sei etwa der Umstand, dass sich zunehmend das „Premium-Segment“ gehobener Gütermärkte vom Massenkonsum abhebt, während „am anderen Ende der Preiskampf der ‚Discounter‘ immer härter wird.“ Anstelle einer „nivellierenden Massengesellschaft“, wie uns allgemein glauben gemacht wird, schaffen diese „Optionen“ eine Kultur, die der Demonstration und Verfestigung von Klassenunterschieden dient. Nolte: „Das Fernsehen ist das beste Beispiel: Der Aufstieg der Privatsender hat ja nicht einfach zu einer ‚Bilderflut‘ geführt, er hat vor allem eine Klassendifferenzierung des Fernsehens bewirkt, die es zur Zeit des Duopols von ARD und ZDF nicht gab. Mit RTL und Sat.1 ist ein spezielles Unterschichtfernsehen entstanden, und deshalb war es nur konsequent, dass sich am anderen Ende der sozialen Skala Sender wie 3sat oder Arte etablierten.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Liebe in Zeiten des Kapitalismus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Liebe in Zeiten des Kapitalismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Liebe in Zeiten des Kapitalismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.