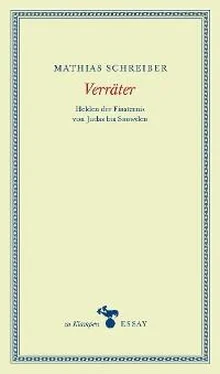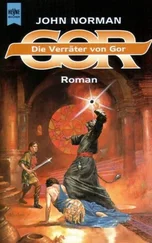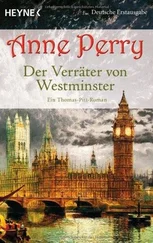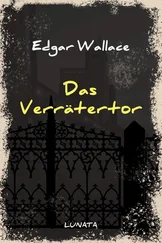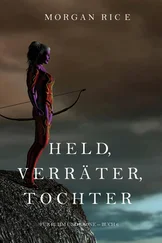»Verräterei, als Keim aller Laster, vereinigt auch die Abscheulichkeit aller in sich«, vermerkt ein schweizerischer Publizist im Revolutionsjahr 1848. Es ist jene turbulente Zeit, in der zwei Nationalversammlungen – eine preußische in Berlin und eine reichsdeutsche in der Frankfurter Paulskirche – um erste halbwegs republikanische Verfassungen für die von Königen, Fürsten und Herzögen aller Art hierarchisch gelenkten deutschen Lande ringen. Die vielstimmigen, langwierigen Debatten der meist akademisch gebildeten Parlamentarier werden schrill und wüst begleitet von allerlei Straßen- und Barrikadenkämpfen, Truppenbewegungen, Hungerrevolten und wütenden Bürgerversammlungen zwischen Paris, Prag, Wien, Berlin, Frankfurt, München, Dresden, Karlsruhe und Offenburg. Da kommt es schon mal vor, dass badische Aufständische – überwiegend (klein-)bürgerlichen Standes – unter Anleitung des linken Anwalts Friedrich Hecker Pressefreiheit und Volksbewaffnung fordern, zur Gründung libertärer »vaterländischer Vereine« aufrufen und von Konstanz aus einen Protestmarsch mit etwa 800 bewaffneten Revoluzzern in Richtung Karlsruher Residenz unternehmen – den berühmten »Heckerzug«. Und dass sie dann von Soldaten des Bundesheeres, mehrheitlich preußischen, zusammengeschossen werden. Hecker setzt sich im Herbst des Jahres ab in die Vereinigten Staaten, er wird Farmer. Er kultiviert wild wachsende Weinreben, die der Reblaus widerstehen, und schickt Kerne der betreffenden Trauben nach Deutschland, wo die Reblaus den Winzern gerade sehr zu schaffen macht. Später befehligt er im amerikanischen Bürgerkrieg als Offizier ein Freiwilligenkorps deutscher Ausgewanderter, die für die Nordstaaten – und gegen die Sklaverei – kämpfen. Hecker hat sein badisches Vaterland verraten, um seinen sozialen und freiheitlichen Überzeugungen treu bleiben zu können. Ein Vaterlandsverräter, der Respekt verdient.
Ein gutes Jahrhundert nach dem »Heckerzug« etablierte sich auf deutschem Boden ein linkssozialistischer Staat, der sich gern auf Leute wie Hecker berief, aber dabei das libertäre Element seiner Überzeugungen unterdrückte. Dieser Staat beschäftigte den Verräter als Staatsdiener: die sogenannte Deutsche Demokratische Republik. In den letzten Jahren vor 1989 hatte sich die Staatssicherheit der DDR rund 300 000 Bürger als hauptberuflich oder nebenberuflich tätige Spitzel verpflichtet, die meisten davon als »Inoffizielle Mitarbeiter« (IM). Sie sammelten unter einem oder mehreren Decknamen vertrauliche Informationen über Arbeitskollegen, Nachbarn, sogar über Freunde und Familienmitglieder und gaben sie weiter an die »Firma«, wie das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) genannt wurde. Dabei war vorrangig gefragt, wie solidarisch der Ausgehorchte über das Regime und seine Ideologie dachte. Es handelte sich um ein absurd aufgeblähtes System der Gesinnungsschnüffelei, des willkommenen Verrats. Ohne den willkommenen Verrat bleiben diktatorische Regierungen selten lange an der Macht.
Die Verräter in diesem System sind zunächst simple Denunzianten, die auch ihnen fremde Personen an ihre Führungsoffiziere der Staatssicherheit verpfeifen. Sobald die Verratenen dem Verräter mehr oder weniger nahestehen, werden aus den schlichten Denunzianten Verräter von bisweilen dramatischer Intensität, die etliche Akteure in die moralische Selbstzerstörung geführt hat. Der Fall des Dichters Sascha Anderson ist in dieser Hinsicht besonders krass.
Der 1953 geborene Lyriker und Layouter hat von 1975 bis zum Ende der DDR 1990 – nach 1986 sogar von West-Berlin aus – über Autoren und Künstler, mit denen er im Rahmen der berühmten, als rebellisch geltenden Berliner »Prenzlauer-Berg-Szene« befreundet war, zum Teil intimste Details an die Staatssicherheit berichtet. Er war unter verschiedenen Decknamen wie »David Menzer« oder »Peters« fest verpflichteter »Inoffizieller Mitarbeiter« (IMB – das »B« steht für »Feindberührung«) des DDR-Spitzelapparates. Einige Male hat er die von ihm Bespitzelten auch noch durch Affären mit deren Ehefrauen zusätzlich betrogen und so allerlei Intimes ausgespäht; so im Fall des Liedermachers Ekkehard Maaß, bei dem er eine Weile wohnen durfte. Zu den von ihm Observierten gehören der Maler Ralf Kerbach sowie die Schriftsteller Elke Erb, Wolfgang Hilbig und Uwe Kolbe.
Mit der politisch unbequemen, originellen Malerin Cornelia Schleime, die er ebenfalls regelmäßig und gründlich für die Stasi abgeschöpft hat, war er jahrelang in einer engen Liebesbeziehung verbunden. Schleime hat darüber eindrucksvoll zornig geschrieben in dem Roman »Weit fort« (2008). Aufgedeckt wurde Andersons Stasi-Karriere im Herbst 1991: Erst durch die satirische Titulierung als »Sascha Arschloch« in Wolf Biermanns Dankrede für den Georg-Büchner-Preis; und dann in einer fünfteiligen »Spiegel«-Serie »Landschaften der Lüge« von Jürgen Fuchs. Der Autor und Psychologe Fuchs (1950 bis 1999) konnte aus echten Stasi-Akten zitieren und alle Vorwürfe gegen Anderson belegen, aus Akten, die in der Wendezeit 1989/90 von DDR-Bürgerrechtlern gesichert worden waren – viele Unterlagen hatte die Stasi selbst 1989 ja noch eilends geschreddert. Biermann hat Andersons Verstrickung als erster öffentlich angesprochen. Er wurde daraufhin von Günter Grass als Großinquisitor attackiert, auch sonst nahm die deutsche Feuilletonpresse (etwa »Die Zeit«) den Angriff des wortmächtigen Liedermachers auf einen »dadaistelnden« (Biermann) Nachwuchs-Lyriker überwiegend recht ungnädig auf, indem sie Biermann unterstellte, er übertreibe und für seine Behauptung fehlten ihm die Beweise. Als die im »Spiegel« publizierten Aktenvermerke diese Beweise – den entscheidenden teilte man mit ironischem Understatement in einer Fußnote mit – nachlieferten, hat außer einem einzigen Fernsehjournalisten niemand von den Bedenkenträgern bei Biermann Abbitte geleistet. In seiner Autobiographie »Warte nicht auf bessre Zeiten!«7 vermutet Biermann wohl zu Recht, der Grund dafür könne, neben dem »Ethos der Unschuldsvermutung«, nicht zuletzt »die Kränkung« gewesen sein, »auf einen politischen Trickbetrüger reingefallen zu sein«. Anderson war – ausgerechnet – Anfang der 1970er Jahre wegen der Verbreitung einiger Biermann-Texte auf Flugblättern vorübergehend inhaftiert worden. Wahrscheinlich hatte die Staatssicherheit bei dieser Gelegenheit seine Anwerbung eingeleitet. Anderson war als Spitzel keine kleine »Feldmaus« (Günter Kunert zu Beginn der Affäre), sondern für Stasi-Chef Mielke »ein Superspitzel«, wie Jürgen Fuchs bezeugt hat, der selbst von diesem Spitzel noch in West-Berlin bearbeitet wurde. Anderson lebt heute im Taunus als Layouter und ist verheiratet mit der Schriftstellerin Alissa Walser.
Bernhard Schlink8 urteilt, die Schärfe und Verachtung, mit der Biermann Andersons Doppelleben als Künstlerfreund und Spitzel anprangerte, habe seinerzeit »gewirkt, als stamme sie aus einer anderen Zeit, einer Zeit der tieferen Loyalitäten, tieferen Überzeugungen und größeren Leidenschaften«. Schlink: »Die große Zeit des Verrats ist vorbei«, denn vorbei sei auch die Zeit der »großen Loyalitäten«, in denen sich »unsere Identität« konstituiere und ihre »Wahrheit« zeige und bewähre. Loyalitäten würden heute – parallel zum schleichenden Vertrauensschwund gegenüber traditionellen Institutionen und Verpflichtungen – »leichter genommen« als früher. Entsprechend verliere die Ächtung des Verrats viel von ihrer alten, normativen Kraft. Letztlich beweise die Empörung über Verrat nur noch die »Sehnsucht nach der tiefen Überzeugung«, die es kaum noch gebe. Schlink verrät, indem er bei dieser Gelegenheit von der vergleichsweise harmlosen Partner-Verletzung durch den »Seitensprung« spricht, dass er die Entwicklung, die er teilweise korrekt beschreibt, letztlich nicht so schlimm findet und insofern in ihrer Bedeutung klar unterschätzt.
Читать дальше