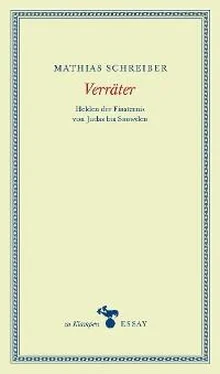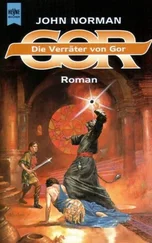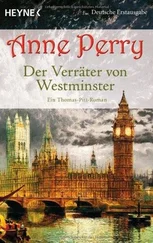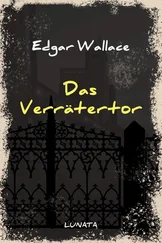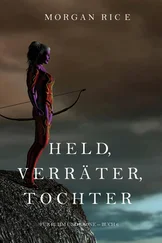Meistens zerbricht der Verräter ein über längere Zeit entwickeltes, darum relativ intensives Verhältnis der Loyalität oder des Vertrauens. Denn ohne tiefere Vertraulichkeit dürfte der Verratene dem Verräter kaum heikle Informationen anvertraut haben, und nur heikle Informationen sind ja wertvoll. Der Verrat bedeutender Geheimnisse ist deshalb fast immer zugleich Freundesverrat. Der Verräter missachtet das Gebot der Treue zu Freunden, die ihm vertrauten; aber auch zu sich selbst, sofern er beansprucht, ein verlässliches, freundschaftsfähiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Der Begriff der »Treue«, wenn er mehr meint als die emotionale Bindung zwischen vertrauten Menschen, benennt eine »unveränderlich gewissenhafte Gesinnung«3. Fremde Personen kann man, etwa bei der Polizei, wegen irgendeines Vergehens anzeigen, also verraten, aber der Begriff des Verrats trifft hier eher technisch zu. Im Sinne des moralisch partout Verwerflichen passt er nur in Fällen schlimmer Denunziation, etwa von Oppositionellen an ein Unrechtsregime. Zu Opfern eines fundamentalen Verratsgeschehens »taugen nur diejenigen, die aufgrund einer bestehenden Vertrauensbeziehung kategorisch damit rechnen dürfen, dass die Treue – koste es, was es wolle – gehalten werde«, so Arnd Pollmann.4 Demnach besteht der Verrat aus der einseitigen Aufkündigung dieses Treueverhältnisses, etwa durch die Preisgabe bedeutender Fakten, die aus der Sicht des Verratenen geheim hätten bleiben müssen. Durch die Weitergabe der geheimen Informationen an Dritte (oder eine Institution) wird aus dem ursprünglichen Treueverhältnis eine unmoralische Dreiecksbeziehung, was den Verrat übrigens von einem Wortbruch unterscheidet, der diese Instanz des Dritten nicht involviert. Pollmann definiert treffend: »Zu einem Verrat kommt es, wenn vertrauliche, durch eine Loyalitätsbeziehung geschützte Informationen, die geeignet sind, der jeweils hintergangenen Person oder Personengruppe gravierende Nachteile zu bescheren und eben dadurch das bestehende Loyalitätsverhältnis zu zerstören, heimlich, d. h. ohne Zustimmung, an Dritte weitergereicht werden.«5 Wenn die Preisgabe der Geheimnisse allerdings unter Zwang, etwa Folter oder Erpressung, geschieht, der Preisgeber die Nachteile für die hintergangene Vertrauensperson also keineswegs gewollt hat, können wir zwar von Verrat reden und diesen auch verurteilen, sollten aber den Auslöser des Vorgangs, den Verräter, nicht allzu streng verdammen.
Zur Semantik des Verrats an einer Gruppe oder Institution gehört eine spezielle duale Struktur: Es gibt stets diejenigen, die dem verabredeten politisch-moralischen Code treu, sozusagen daheim geblieben sind; und auf der anderen Seite die Abweichler, die Nest-Flüchtigen, die Verräter der Truppe. Die Treuen verurteilen die Abweichler als Verräter; die Abweichler selbst sehen sich ganz anders: als Revolutionäre, Erneuerer, produktive Zerstörer verkrusteter Strukturen, mutige Enthüller unwürdiger oder gar gefährlicher Geheimnisse. Die Identität der beiden Gruppen ist selten so kompakt, die Motive ihrer Akteure sind selten so eindeutig, dass die Analyse bei der ursprünglichen Zweiteilung in Bleibende und Flüchtige, Heim-Treue und Fremdlinge stehen bleiben darf. Die Fronten wechseln wie die Identitäten. Dieses Verrats-Geschehen ist besonders verwirrend.
Die häufigsten Verräter-Typen sind Spione, Doppelagenten, Denunzianten, Konvertiten, Renegaten, Überläufer, Ausplauderer von Geschäftsgeheimnissen, Hochverräter, Ketzer, Abtrünnige von Freundeskreisen, Vereinen, Ämtern, Geheimbünden, Ehebrecher. Im Ehebruchs-Dreieck ist der profitierende Dritte diejenige Person, mit der einer der Ehepartner die Ehe bricht. Der Code, der hierbei desavouiert wird, ist das bei der Eheschließung gegebene Treue-Versprechen und das meistens als ausschließlich, wenn nicht »absolut« empfundene emotionale Zweierbündnis, das sich im Lauf der Zeit gebildet hat.
Besonders kompliziert ist die Abgrenzung zwischen gängigem Verräter und denunziatorischem Verräter. Der Denunzierte ist nicht, wie der Verratene im landläufigen Sinn, notwendig eine Vertrauensperson des Denunzianten. Die römische denuntiatio meint schlicht eine »Mitteilung an das Gericht«. Der Begriff des »Denunzianten« wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein wertneutral gebraucht, im Sinne einer prozessrechtlichen Bestimmung. Noch im späten 18. Jahrhundert ist die Rede vom »Amt eines Denuncianten« wie von einer Vorform der Staatsanwaltschaft, wobei es etwa um das Anzeigen, um den »geheimen Angeber« eines Betrugs bei der für die öffentliche Ordnung zuständigen Obrigkeit geht. Wer so denunzierte, tat etwas Nützliches, geriet freilich insofern rasch in schlechtes Licht, als die Methode, mit der er seine Beweise beschafft hatte (Belauschen eines Gesprächs, Diebstahl von Akten?), oder auch die Motive, aus denen er zum »Angeber« geworden war (Rachsucht, Karrieregründe, Gier nach Belohnung), sowie die mit dem Anzeigen verbundene Heimlichtuerei und womöglich auch der Bruch einer zugesagten Verschwiegenheit als moralisch anrüchig galten. Ein auch vor Gericht als Zeuge akzeptierter Denunziant musste eigentlich einen unbescholtenen Ruf haben und durfte offensichtlich nicht aus privatem Interesse, sondern sollte möglichst glaubwürdig vor allem um der Gerechtigkeit willen ein Vergehen anzeigen. Daneben war durchaus schon der eindeutig negativ besetzte Begriff der »Verrätherey« gebräuchlich, etwa für das Abrücken von einem vorher geleisteten Eid.
Der Soziologe Michael Schröter hat die »Wandlungen des Denunziationsbegriffs« genau rekonstruiert.6 Schröter illustriert den technisch-juristischen Sinn des alten Denunziations-Begriffs mit folgendem Fall aus dem Jahr 1804, den er der 1831 von J. D. F. Neigebaur verfassten »Geschichte der geheimen Verbindungen der neuesten Zeit« entnimmt: Einige preußische Offiziere streiten sich in einem Ausflugslokal an Pfingsten mit den Inhabern des Wirtshauses. Ein Leutnant hat einen Stuhl umgeworfen, woraufhin ihn die Wirtsfrau einen »dummen Jungen« nennt. Er fühlt sich provoziert und stößt sie zu Boden. Ihr Mann springt ihr bei und bezichtigt die Gäste der beleidigenden »Stänkerei«. Daraufhin wird er mit einem Degen bedroht und als »Hund« beschimpft. Nach der »Denunciation«, also der Anzeige der Wirtsleute, werden die Streithähne vor Gericht verhört. Der Leutnant, der den Wirt mit dem Degen bedrohte, beendet seine Aussage mit den Sätzen: »Ich glaube daher, dass nach Vorstehendem die Denuncianten nicht im geringsten berechtigt sein, eine gesetzliche Genugthuung zu verlangen, da mein Betragen erst durch ihre Grobheiten und Beleidigungen herbeigeführt worden, und bitte daher die Denuncianten mit ihrer angebrachten Denunciation gänzlich abzuweisen.« Der Leutnant führt dann eine »Gegenbeschwerde« gegen die Wirtsleute auf, das Gericht verhandelt nunmehr eine »De- und Redenunciationssache« – der Fall endet wie das Hornberger Schießen.
Das »Anzeigen« bestimmter Vergehen bei der Obrigkeit ist erst dann durchweg anrüchig, wenn diese Obrigkeit nicht als gutartig gilt oder sogar zu einem offensichtlichen Unrechtsregime gehört. Erst hier kommen die Begriffe »Verrat« und »Denunziation« (pejorativ verstanden) zur Deckung, wie es zum Beispiel das berühmte Diktum des »Deutschlandlied«-Dichters Hoffmann von Fallersleben impliziert: »Der größte Lump im ganzen Land/das ist und bleibt der Denunziant.« Hoffmann von Fallersleben gehört zu jenen libertären Patrioten des 19. Jahrhunderts, die den Kampf um die politische Einheit der deutschen Lande primär als Freiheitskampf – gegen Napoleon, gegen Zensur und andere Repressionen der preußischen oder habsburgischen Obrigkeit – verstanden haben.
Einer, der die libertären Ideale dieser ungestümen, durchaus nicht reaktionären Patrioten, etwa des berühmten Pädagogen und »Turnvaters« Friedrich Ludwig Jahn, verhöhnt und offen seine Sympathie mit den gestrigen Monarchen in Wien und Berlin bekennt, ist der Vielschreiber August Kotzebue (1761 bis 1819). Er zeugte mit drei Ehefrauen nicht weniger als 17 Kinder und schrieb 38 ernste Theaterstücke sowie 45 Lustspiele. Im Liberalismus der jungen Deutschen sah er, der eine Zeitlang dem russischen Zaren als Generalkonsul diente, eine »Brutstätte der Revolution«. 1819 wird Kotzebue von einem Jenaer Burschenschaftler und Theologiestudenten erstochen. Der Mörder soll dabei gerufen haben: »Hier, du Verräter des Vaterlands!« – 1819!
Читать дальше