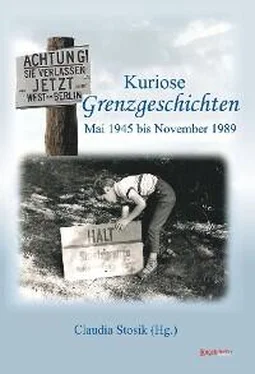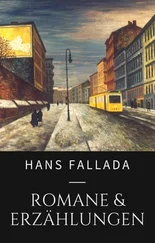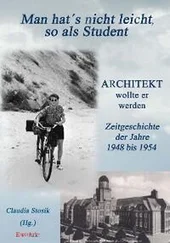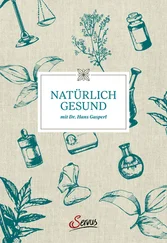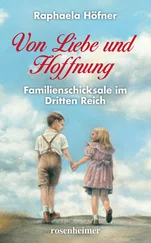Für unsere Verwandten aus dem Westen hatten die Grenzen schon frühzeitig ihren trennenden und abschreckenden Charakter verloren, denn die westliche Welt bot Bewegungsfreiheit in überreichem Maße. Es fiel ihnen deshalb nicht schwer, die letzte, noch unbehagliche Gefühlte weckende Grenze, die Trennungslinie zwischen Ost und West am „Eisernen Vorhang“, als gegeben hinzunehmen, zumal eine landläufige Meinung besagte, daß hier ohnehin die Welt zu Ende sei, und dahinter nur Kommunisten und Russen ihr Unwesen trieben. Für den gewöhnlichen DDR-Bürger dagegen blieben die ihn umschließenden Grenzen bis zuletzt nur schwer zu überwindende Hindernisse, die seine Oberen aufgetürmt hatten in dem Wahn, nur dadurch ihre und ihres Staates Existenz bis in alle Ewigkeit sichern zu können. Erst mit der „Verordnung über Reisen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik nach dem Ausland“ vom 30. November 1988 gab es eine gesetzliche Grundlage, die regeln sollte, wer, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Richtung die Grenze überschreiten und das Vaterland verlassen durfte. Bis dahin war staatliche Willkür oberstes Gesetz. Auch davon wird in den Grenzgeschichten die Rede sein.
Die Grenzgeschichten schreibe ich auf...
1.weil es sein könnte, daß meine Kinder, Kindeskinder oder wer auch immer, später einmal, wenn die Gegenwart Geschichte geworden ist, gern mehr darüber wissen möchten, wie das damals war, und was ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern u.s.w. widerfuhr,
2.weil mir dazu, wie bereits erwähnt, einiges Material zur Verfügung steht, und
3.weil Grenzgeschichten in Verbindung mit dem „Reiseverbot“ dazu beitrugen, daß sich manch Bewohner der DDR von seinem Staat lossagte, sei es gedanklich oder die Gedanken in die Tat umsetzte.
Soweit die Vorbemerkung und nun die Grenzgeschichten, vierzehn an der Zahl.
Aufgeschrieben im Jahre 1993
***
ERGÄNZENDE GEDANKEN
Diese Geschichten schrieb mein Vater Anfang der 1990er Jahre auf. Punkt 1 kann schon bestätigt werden, denn ich wollte nicht nur mehr über die Geschichte wissen, sondern auch einige Grenzgeschichten aus meinem eigenen Erfahrungsschatz ergänzen.
Die damaligen innerdeutschen Grenzen sind heute nicht mehr vorhanden. Auch Berlin ist wieder von allen Seiten zugänglich. Die sogenannte Freundschaftsgrenze zur damaligen ČSSR hat heute ebenfalls ihren trennenden Charakter verloren. Ganz wie es beliebt, können Wanderungen grenzüberschreitend unternommen werden. Im Vertrag von Eger im Jahr 1459 wurde die Grenzfestsetzung zwischen Sachsen und Böhmen besiegelt. Diese Grenzlinie regulierte die Gebietsansprüche beider Länder bzw. der Herrscherhäuser der Wettiner und der böhmischen Könige, hatte also keinen nationalen oder sprachlichen Hintergrund. Die Grenzfestlegung hat sich übrigens bis heute kaum verändert und ist somit die am längsten bestehende Grenze Europas.
Das Jahr 1961 war ein einschneidendes Jahr bezüglich Grenzschließung und deshalb habe ich in diesem Kapitel Eindrücke und Wahrnehmungen meiner Verwandten zur Sprache gebracht, welche sich während eines Briefwechsels vorsichtig zum Thema Mauerbau äußerten. Die große Politik kann in diesem Büchlein nicht erörtert werden, dazu findet man in der Fachliteratur genügend Informationen. Doch wie haben sich die Menschen vor allem in der DDR mit der Abriegelung zum westlichen Ausland abgefunden? Auch die Westdeutschen waren die ersten Jahre von der Grenzregelung mit betroffen, denn ihnen verwehrte man die Einreise in den anderen Teil Deutschlands.
In den 1980er Jahren spitzten sich die politischen Verhältnisse zu, denen die DDR-Regierenden am 9. November 1989 nichts mehr entgegensetzen konnten außer den Schlagbaum an der Bornholmer Brücke in Berlin zu öffnen – für immer!
Ein neues Kapitel der deutschen Geschichte begann. Diese und andere Episoden werden in dieser kleinen Publikation erzählt.

Die deutsch-tschechische Grenze auf dem ehemaligen Fremdenweg in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz
***
Wie ich im Mai 1945 ganz unvermutet auf eine Grenze stieß, die es bis dahin in Deutschland noch zu keiner Zeit gegeben hatte, und wie ich ebenfalls ganz unvermutet, die Sowjets von ihrer allerbesten Seite kennenlernte.
Am 11. Mai 1945, drei Tage nach der bedingungslosen Kapitulation, die in Deutschland den Zweiten Weltkrieg beendete, stand ich als junger Soldat, der mit gemischten Gefühlen seine Flinte ins Korn geworfen, der die Wirren der letzten Wochen ohne Schaden zu nehmen überstanden und dessen Einheit sich sang und klanglos aufgelöst hatte, ganz unvermutet an einer Grenze, die es erst seit wenigen Tagen gab, an der Demarkationslinie zwischen den amerikanischen und den sowjetisch besetzten Teilen Deutschlands. Diese Grenze verlief damals an der Zwickauer- und vereinigten Mulde bis zu deren Einmündung in die Elbe, dann weiter stromabwärts, war bereits in jenen Tagen nicht mehr frei passierbar und wurde, besonders auf der westlichen, amerikanischen Seite, scharf bewacht.
Erst am 9. Mai hatten uns die Ereignisse ziemlich nachdrücklich belehrt, dass der Krieg zu Ende war. Im Morgengrauen dieses Tages fanden sich die Reste meiner Einheit nach einer Nachtfahrt über den Kamm des Erzgebirges hinweg, irgendwo im böhmischen Mittelgebirge wieder. Uns weiter nach Westen und bis zum Ami durchzuschlagen, so lauteten die letzten Befehle. Aber der Iwan hatte, wie sich bald herausstellte, den letzten, noch verbleibenden Rückzugsweg schon abgeschnitten, und so landete ich zwangsläufig noch am gleichen Tage, gemeinsam mit Tausenden anderer deutscher Soldaten als Gefangener auf einem Sportplatz am Stadtrand von Teplitz.
Als ich nach mehrstündiger Ungewissheit zu begreifen begann, in welch missliche Lage ich geraten war, als ich begann, mich in Gedanken mit dem Abmarsch in Richtung Sibirien vertraut zu machen, geschah, was ich auch heute noch fast wie ein Wunder ansehe: Die Sowjets ließen uns laufen, nicht nach Sibirien, nicht nach Russland, „Wojna kaput, nach Hause“ 1, war die Parole. Wir ließen uns das nicht zweimal sagen und versuchten, um einem eventuellen Sinneswandel zuvorzukommen, so schnell wie möglich die alte Reichsgrenze zu erreichen. Gerüchte besagten, drüben solle bereits der Ami sein. Die pausenlos vom Kamm des Gebirges herab und in Richtung Teplitz rollenden Panzer, Stalinorgeln, LKW´s besagten allerdings etwas anderes. Wie eine stählerne Lawine wälzte sich die Kriegsmaschinerie zu Tal. Um nicht unter Räder und Ketten zu geraten, versuchten wir im Straßengraben voranzukommen, stolperten dabei über Ausrüstungsgegenstände, umgingen Fahrzeugwracks. Stellenweise brannte der Wald. Die Toten im Straßengraben wurden von der Dunkelheit barmherzig zugedeckt. In allen Richtungen soweit ich blicken konnte, stiegen farbige Leuchtkugeln in den Himmel: Das Siegesfeuerwerk.
Wie oft wir in dieser Nacht angehalten und durchsucht wurden, habe ich nicht gezählt. Nach Waffen hat hier keiner mehr gefragt, die Uhren wollten sie und manchmal auch Schnaps. Aber auch das habe ich nicht vergessen: Von ihren Panzern reichten uns russische Soldaten im Vorüberfahren Schokolade herunter, „Wojna kaput“ .
Noch vor Mitternacht erreichten wir unser erstes Ziel, überschritten wir in Zinnwald die sächsisch-böhmische, die alte Reichsgrenze. Auch hier verwehrte uns niemand, trotz mitternächtlicher Stunde weiterzumarschieren. 2Erst in Altenberg wurden wir von einer Patrouille aufgehalten und für den Rest der Nacht in einem ausgeplünderten Haus eingesperrt. Russische Soldaten, im Nachbarzimmer einquartiert, wollten nicht einmal unsere Uhren haben. Vor ein paar Tagen hätten wir uns noch gegenseitig abgemurkst.
Читать дальше