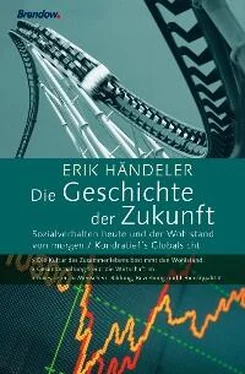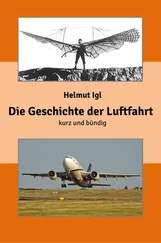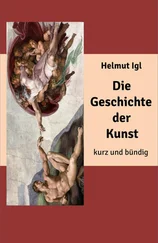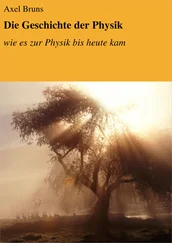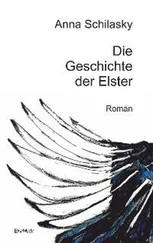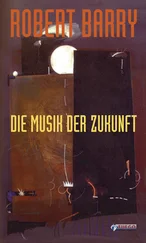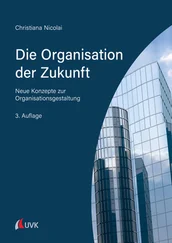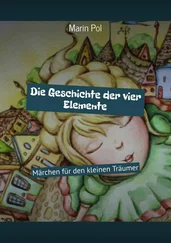Auch der Handel mit den Kolonien ist verschwindend gering: Während das Deutsche Reich 1913 Waren für 10.039 Millionen Mark in alle Welt exportiert, kaufen die eigenen Kolonien dem Mutterland nur Waren für 57 Millionen Mark ab. Denn das, was der dritte Kondratieff braucht – Kohle, Erz, Fabrikarbeiter –, findet sich nicht im Pazifik oder in Kamerun, sondern in Deutschland. Die Kolonien erfüllen einen Zweck nur als innenpolitisches »Wir-sind-wieder-Wer« und zur eigenen Beruhigung, angesichts der Depression doch irgend etwas für die Zukunft getan zu haben. Es ist derselbe Grund, der die Menschen während des langen Kondratieffabschwungs nach einem Schuldigen suchen lässt.
Jede Wirtschaftskrise braucht ihre Sündenböcke
Niemand kann die plötzliche und so heftige Wirtschaftskrise begründen. Die Nationalliberalen meinen, Schuld an der Depression sei vor allem die Überproduktion der Industrie, und dieses Problem – so die Lehre der klassischen Wirtschaftstheorie – werde sich mit der Zeit von selbst lösen. Doch darauf warten sie vergeblich. Und weil sich auch die Zeitgenossen den Verlust ihres ein Leben lang ersparten Vermögens nicht plausibel erklären können, müssen eben dunkle semitische Mächte dafür verantwortlich sein: die Kapitalisten, und das sind in dieser Zeit aus historischen Gründen überdurchschnittlich viele Deutsche jüdischen Glaubens. Nirgends in Westeuropa leben so viele Juden wie im Deutschen Reich (700.000). Allein in Berlin gibt es mit 50.000 so viele Juden wie in ganz Großbritannien und mehr als in ganz Frankreich (40.000). Magnaten wie Rothschild, Oppenheim oder Bleichröder ziehen den Volkszorn auf alle Juden, egal, wie reich oder arm diese sind. Journalisten weisen bei Enthüllungsgeschichten zu Firmenpleiten immer wieder auf die jüdischen Wurzeln der Akteure hin. Die bejubelten Börsenmakler von 1872 sind auf einmal verachtete »Börsenjuden«.
In Wahrheit geht es den meisten darum, die jüdischen Mitbürger möchten doch bitte nicht ständig das Selbstwertgefühl der germanischen »Herrenrasse« in Frage stellen. August Bebel, die große Figur der Sozialdemokraten im 19. Jahrhundert, bezeichnet den Antisemitismus als »eine Art Sozialismus der dummen Kerls«. Es ist das »Stehkragenproletariat« der kleinen Angestellten und Beamten, das die Tüchtigkeit der Juden fürchtet, ebenso die kleinen Ladenbesitzer und Handwerker: 1885 sind zehn Prozent aller preußischen Studenten Juden – siebenmal so viel wie ihr Bevölkerungsanteil. In Berlin sind drei Prozent der Bevölkerung Juden, aber jeder zweite Unternehmer in der Hauptstadt. Mit der Zeit nimmt der Antisemitismus auch in der Oberschicht zu, dort dann esoterisch angehaucht. Selbst der evangelische Hofprediger Adolf Stöcker predigt gegen die Juden, weil er so politisches Kapital schlägt für seine Christlich-Soziale Arbeiterpartei, die vor allem unter Kleinbürgern Wahlerfolg hat. Antisemitismus und rechte Verschwörungstheorien werden gesellschaftsfähig. Sie werden die ganze Krisenzeit hindurch bis hinein in die Kinderjahre Adolf Hitlers in den 1890er Jahren wiederholt und leben dann in der Weltwirtschaftskrise erneut auf.
Georg Tietz aus der Dynastie der Hertie-Kaufhauskette erlebt schon damals in der Krise des zweiten Kondratieffs, was andere Deutsche jüdischen Glaubens genau einen Strukturzyklus später im Nationalsozialismus erleben: Je erfolgreicher er ist, umso verbissener wehren sich die im Wettbewerb unterlegenen Einzelhändler. Sie stellen Posten vor sein Münchener Kaufhaus am Karlsplatz, die den Kunden Flugblätter in die Hand drücken und sie vor dem Einkauf bei den »Juden« warnen.47 Ein anderes Mal zieht die Menge nach einer Einzelhandels-Versammlung zum Kaufhaus, wirft mit Pflastersteinen die Fenster ein und blockiert es. Corpsstudenten gehen hinein, belästigen die Verkäuferinnen, schlagen einen Mitarbeiter blutig, werfen die Waren durcheinander. Tietz ruft die Polizei, doch die lehnt es ab, gegen »Söhne der ersten deutschen Familien« einzuschreiten. Nur mit Hilfe eines befreundeten Bäckers und seiner Gesellen gelingt es ihm, die nationalistische Studentenschaft rauszuwerfen. Was sich hier Luft macht, ist die eigene wirtschaftliche Unzufriedenheit.
Soziale Probleme im langen Abschwung
Denn niemand ist von den geringen Gewinnspannen im langen Kondratieffabschwung so sehr betroffen wie die Unterschicht. Nach dem Gründerkrach fehlen in den wachsenden Großstädten bald wieder billige Mietwohnungen. Hunderttausende von »Schlafburschen« zahlen für ein paar Kreuzer einen Schlafplatz in einer Familie, zum Teil übernachten bis zu vier Personen in einem Bett. Dass Bismarck in den 1880ern Kranken-, Unfall- und (Arbeiter-)Rentenversicherung einführt (damit die Arbeiter nicht alle der SPD zulaufen), zeigt, dass die Not in diesen Jahren größer ist als zuvor – eben ein Kondratieffabschwung.
Den Unterschicht-Frauen geht es überall dreckig. Rechtlos, abhängig und niedrigst bezahlt, vermögen sie sich »in ihrer abhängigen Lage dem Herrn, dem Verwalter und dem Knecht gegenüber selten zu wehren«, stellt eine Studie des evangelischen Sittlichkeitsvereins von 1890 fest. Die Flucht in die Stadt ist nur ein Tausch der Unfreiheiten: Entweder sie arbeiten in einer Fabrik, was in der Regel ziemlich ungesund ist und mit drei bis sechs Silbergroschen weit schlechter bezahlt wird als etwa männliche Drucker oder Färber, die zwischen 15 und 25 Silbergroschen am Tag bekommen. Oder sie ergattern sich eine Dienstbotenstellung, in der sie rund um die Uhr den Herrschaften zur Verfügung stehen und mit etwa 30 Jahren verbraucht sind – 1882 gibt es rund 1,3 Millionen Dienstboten im Deutschen Reich. Viele Näherinnen, Kellnerinnen oder Fabrikmädchen dürften mit Prostitution ein Zubrot für ihr Überleben verdienen. In München wird 1890 jedes dritte Kind unehelich geboren.
Die Arbeiter sind mit Alltagssorgen so beschäftigt, dass es selbst die pragmatischen Sozialdemokraten schwer haben, unter ihnen Fuß zu fassen. Die Sozialistenführer Bebel und Liebknecht haben noch vor dem Gründerkrach ein Bündnis mit dem Bürgertum angestrebt – aber angesichts der Situation in den Krisenjahren nach 1873 scheitert es an sozialen Fragen wie Lohn und Arbeitsverhältnissen. Im langen Abschwung müssen sich die Arbeiter nach langen Streiks und Arbeitskämpfen geschlagen geben und für weniger Lohn arbeiten. Vom Bürgertum im Stich gelassen, vom Staat ausgegrenzt, reagieren die Sozialdemokraten auf die neuen strukturellen Verhältnisse im Mai 1875 auf ihrem Parteitag in Gotha mit einem marxistisch geprägten Programm, das der politischen Ordnung offen den Kampf ansagt.
Um sie in Schach zu halten, reichen Nationalismus und Kolonialgerassel allein nicht aus (siehe oben). Bismarck schiebt ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. den Sozialisten in die Schuhe und rechtfertigt damit am 21. Oktober 1878 das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«. Versammlungen, Parteiarbeit und Druckschriften werden erschwert oder gleich ganz verboten. Die soziale Frage – im Kondratieffabschwung besonders brennend – beantwortet der Staat brutal und hart im Sinne der herrschenden Zirkel, um dem »Staatssozialismus einer revolutionären, nicht mehr steuerbaren Arbeiterbewegung« zuvorzukommen. Erst als sich mit dem Aufschwung des nächsten Strukturzyklus die Marktmacht der Arbeiter wieder verbessert, wird die 1891 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) umbenannte Partei stärkste innenpolitische Kraft.
Ebenso wenig zimperlich geht der Staat mit der katholischen Kirche um. Der Papst wendet sich schon 1864 mit der Enzyklika »Syllabus errorum« gegen den Liberalismus – das ist in den Hochkonjunkturjahren des zweiten Kondratieffs so ziemlich das Gegenteil des Zeitgeistes. Nachdem das neue Reich die Kirche auf vielen Gebieten als Konkurrenz empfindet (Eheschließung, Bildung, Zielvorstellungen des Lebens), verstößt der preußische Staat selber gegen liberale Grundsätze wie etwa den Wettbewerb der Meinungen und besten Ideen: Der »Kanzelparagraph« verbietet Pfarrern, staatliche Angelegenheiten anzusprechen. Alle Klöster in Preußen sowie alle Niederlassungen der Jesuiten in Deutschland werden verboten, nicht-deutsche Geistliche ausgewiesen, 1876 alle preußischen Bischöfe verhaftet oder ausgewiesen. Für Bismarck wird der Kulturkampf eine peinliche Niederlage: Das Kirchenvolk rückt umso enger zusammen, je mehr es vom Staat gegängelt oder der Freiheitsrechte beraubt wird, die katholische Zentrumspartei verdoppelt bei den Reichstagswahlen ihre Stimmen. In den 1880er Jahren lenkt Bismarck ein. Er hat genug anderen Ärger, zum Beispiel finanzielle Verteilungskämpfe mit dem Reichstag auszufechten.
Читать дальше