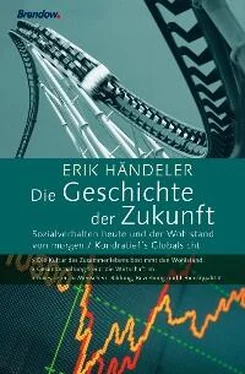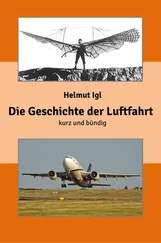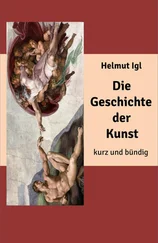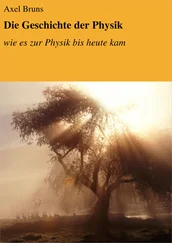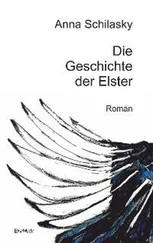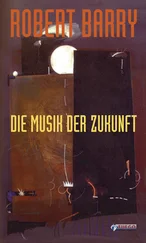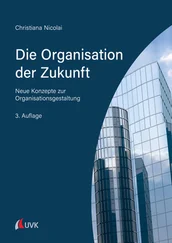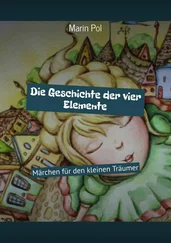Das proletarische Bewusstsein, das sozialistische Theoretiker propagieren, will aber nicht so richtig aufkommen – trotz der Not von Frauen, Kindern und dem harten Arbeitsleben, trotz der Ausbeutung. Vom obdachlosen Tagelöhner bis zum unermesslich reichen Industriemagnaten: Die Industrialisierung hat die Gesellschaft so stark diversifiziert, so viele neue Rangstufen geschaffen, dass nun jeder danach trachtet, wenigstens bis zur nächsthöheren Schicht aufzusteigen. Statt einfach als Bauer, Handwerker oder Adeliger zugeordnet werden zu können, hat sich das öffentliche Leben zu einem Kastenwesen entwickelt, in dem jeder die Möglichkeit bekommt, sich als ein höheres Wesen zu fühlen. Selbst der Tagelöhner erster Klasse kann noch auf den Tagelöhner zweiter Klasse herunterschauen. Das ist so wie heute in Südafrika, wo zwar jeder in eine Kirche geht, dafür aber gerade unter Schwarzen ganz genau registriert wird, wie schwarz, wie weiß, also in welchem Maße gemischt jemand ist – davon hängt dann das gesellschaftliche Prestige ab.
Die deutschen Adeligen leiden zwar insgeheim darunter, dass sie von den sozialen Aufsteigern wie Krupp, Thyssen oder Borsig in der Regel an Geld, Wissen und Tüchtigkeit längst überholt worden sind. Aber sie finden einen genialen Trick, ihren höheren Rang mit formalisiertem Verhalten zu kitten: Geld und Tüchtigkeit reichen nicht – man muss die Etikette der vornehmen Verhaltensweisen beherrschen. »Vor der Raffinesse des höfischen Zeremoniells schrumpfen sie (die Neureichen) unversehens wieder aufs plumpe bürgerliche Normalmaß zusammen.«36 (Das wirkt noch heute überall dort weiter, wo die formale Höflichkeit wichtiger ist als die Höflichkeit des Herzens.)
Während in den USA derjenige ein toller Typ ist, der eine Fabrik aufbaut oder erfolgreich eine Bank führt, ist in Preußen jeder kleine Leutnant einem noch so erfolgreichen Geschäftsmann überlegen. Und ein brillanter Professor hat in der preußischen Hackordnung selbst gegen einen leicht verblödeten Major das Nachsehen. Künstler, Philosophen und Geschichtsschreiber wiederum verunsichern Geld- und Blutsadel damit, den höchsten Rang den Geistesgrößen zuzuschreiben – also ihresgleichen – und sich so selbst an die Seite der Mächtigen zu stellen. Eine kooperative, christliche Gesellschaft ist das wahrlich nicht, egal, wie viele Kirchen gebaut werden. Die Zeiten waren früher weder besser noch christlicher als heute. Allein die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin: Da wird eine Kirche nicht einem Heiligen oder der Auferstehung Christi geweiht, sondern dem obersten Hierarchen des diesseitigen Staates ein Heiligenschein verpasst – ein Trick, um die Kraft der Gottgläubigkeit für die eigene Macht auszunützen. Klar, dass später mit der Niederlage des Kaisers im Ersten Weltkrieg für manche auch der liebe Gott abdankt.
Nur ein langer Aufschwung verbessert die Situation der Unterschicht
Je länger dieser zweite Kondratieffaufschwung andauert, umso heißer läuft die Konjunktur. Abgesehen von schwierigeren Jahren 1857/60 geht es mit der deutschen Wirtschaft ständig bergauf. Damit werden alle Produktionsfaktoren immer knapper, auch Arbeit. In jedem Verlauf eines langen Kondratieffaufschwungs verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeiter – je mehr die Geschäfte der Unternehmer florieren, umso wirksamer ist ein Streik. Besonders im Krieg ist die Konjunktur bis zum äußersten angespannt – die ersten größeren Streiks finden statt im Kriegsjahr 1864 (gegen Dänemark), angezettelt von örtlichen Arbeitern. Und die Fabrikanten geben nach – was sie dank der Kriegskonjunktur auch können. Die höchsten Lohnsteigerungen setzen die Arbeiter in den Boomjahren 1870/73 durch. Da alle Branchen rotieren und täglich neue Aktiengesellschaften gegründet werden, wird der Faktor Arbeit knapp – trotz der Zuwanderung aus dem Osten. Einzelne Streiks, die auf Betriebe oder regionale Branchen beschränkt sind, erkämpfen in Einzelfällen 25 oder gar 35 Prozent mehr Lohn (ähnlich den 14 Prozent Lohnsteigerungen, welche die Gewerkschaften Anfang der 1970er Jahre durchsetzen).
Das ist nun so gar nicht nach dem Drehbuch von Karl Marx, der sein Werk vor allem unter dem Eindruck des ersten Kondratieffabschwungs geschrieben hat. Der Kapitalismus bricht nie zusammen, weil die Profitraten der Unternehmer eben nicht immer nur fallen, sondern im nächsten langen Aufschwung wieder saftig steigen. Der Marxismus ist damit schon obsolet, als sich der zweite Kondratieff entfaltet. Statt Konfrontation setzen die ersten deutschen Gewerkschaften wie die Barmer und Elberfelder Türkisch Rotfärber-Gesellschaft 1848 im Kondratieffaufschwung eher auf Kooperation mit den Arbeitgebern. Pragmatische Führer wie Ferdinand Lassalle wollen reale politische Macht gewinnen: Die Arbeiter sollen sich als politische Partei organisieren, die das allgemeine und gleiche Wahlrecht anstrebt. Nachdem die tägliche Arbeitszeit von 14 Stunden in den 1840ern auf zwölf Stunden sinkt, bleibt neben dem Schlaf erstmals freie Zeit, die eigenen Interessen zu organisieren. 1863 gründet Lassalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der die Arbeiterbewegung sammelt. Nachdem er ein Jahr später bei einem Duell aus lächerlichem Anlass stirbt (seine Geliebte ist zu ihrem Ex-Verlobten zurückgekehrt), zerfällt der Arbeiterverein teilweise.
Wilhelm Liebknecht und August Bebel gründen 1869 in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, mit der Lassalles Anhänger 1875 unter dem Namen Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands zusammengehen. Nur leider sind jetzt mit den wirtschaftlich guten Zeiten auch die politisch guten Zeiten für die Arbeiterbewegung vorbei: In den Krisenjahren ist die Verhandlungsposition der Unternehmer stets besser (wie in jedem langen Abschwung). Dass es zum großen Gründerkrach mit anschließender lang andauernder Wirtschaftskrise kommt, ist jedoch keine Laune des Wetters oder der Finanzmärkte, sondern liegt daran, dass sich das technologische Netz des zweiten Kondratieffs allmählich erschöpft.
Was wir 2001 und 2008 aus dem Gründerkrach von 1873 hätten lernen können
Weil nicht der Staat, sondern die Privatwirtschaft den Eisenbahnzyklus vorantreibt, kommt das nötige Kapital aus der wohlhabenderen Mittelschicht: Wer Anteile kauft, verleiht sein Geld zu einem Zinssatz, den er nicht kennt, weil der davon abhängt, wie rentabel sich die Firma in Zukunft entwickeln wird. Schon in den 1860ern werden die Eisenbahn- oder Bankaktien für immer mehr Leute attraktiv. 1870/71 fallen die Aktienkurse zunächst – durch einen externen Schock: Den deutsch-französischen Krieg. Doch dann bricht ein beispielloses Aktienfieber aus: Mittlere Familienunternehmen werden in Aktiengesellschaften umgewandelt. Ein Finanzkomitee kauft dem bisherigen Besitzer die Firma zu einem weit überhöhten Preis ab, zweigt sich in Form von Spesen, Provisionen und Gebühren eine ordentliche Summe ab und gibt dann so viele Aktien aus, dass das Grundkapital zwei bis dreimal so hoch ist wie der tatsächliche Wert des ganzen Betriebes.
Gut aufgemachte Prospekte und sensationelle Zeitungsberichte treiben das zahlungsbereite Publikum zu. Sie erzeugen künstlich Knappheit, indem nur einige Banken die Aktien anbieten – und nur am ersten Tag noch zum Ausgabekurs von 100 Prozent. So suggerieren sie, nur der könne schnell reich werden, der sofort zugreift. Alle wollen möglichst viel verdienen und möglichst wenig dafür tun. Immer zahlreicher werden Finanzmakler, die in der Nachbarschaft Aktien anbieten. »Niemand machte sich mehr die Mühe, auf solide Art zu wirtschaften, alles musste möglichst schnell gehen und möglichst hohe Gewinne abwerfen«, schreibt der Journalist Günter Ogger in seinem Bestseller »Die Gründerjahre«.37
Die preußische Regierung reagiert am 27. Juni 1870 mit dem neuen Aktiengesetz auf die wachsende Nachfrage und räumt wesentliche Hindernisse aus dem Weg: Jetzt ist keine staatliche Konzession mehr nötig, um eine AG zu gründen, sondern jeder darf so oft und so viel gründen, wie er will; Geschäftsleitungen sind keiner Kontrollbehörde mehr unterworfen. Sind in den fast drei Generationen zwischen 1790 und 1870 nur 300 Aktiengesellschaften zum Börsenhandel zugelassen worden, so kommen in den beiden (!) Jahren 1871/72 über 780 neu hinzu – also im Schnitt eine am Tag.
Читать дальше