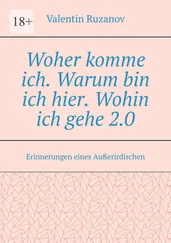Im Geheimen entstand damals „Raqqa Is Being Slaughtered Silently“ (RBSS), ein Internetblog von Oppositionellen. Auf Arabisch hat dieser Name einen poetischen Klang. Anfangs arbeiteten die Bürgerjournalisten noch von ar-Raqqa aus, machten heimlich Fotos, schrieben Texte, verbreiteten sie. Nach der ersten Exekution eines Kollegen tauchten sie unter, flohen über die türkische Grenze – und machten weiter: Sie stellten Fotos, Bilder, Videos und Nachrichten online, die sie von Vertrauensleuten aus ar-Raqqa geschickt bekamen. RBSS war für die westliche Welt jahrelang die wichtigste unabhängige Informationsquelle aus dem Kalifat.
Es muss ein Leben wie im Gefängnis gewesen sein. Einem Gefängnis, das noch dazu aus der Luft angegriffen wurde: Amerikaner und Franzosen bombardierten den IS, die syrische Regierungsarmee bombardierte verschiedene Rebellengruppen und das eigene Volk, an ihrer Seite bombten auch die Russen, die türkische Armee bombardierte Kurden. Und alle Bomben trafen natürlich auch die Zivilbevölkerung.
Wer konnte, floh in dieser Zeit in ein Nachbarland. Aber dort waren schon so viele: 1,2 Millionen im Libanon; zwei Millionen in der Türkei. Die Grenzen waren zu dieser Zeit noch offen. Für die Türkei brauchten Syrer kein Visum. Sie konnten sich legal im Land aufhalten, aber versorgt wurden sie nicht. EU-Hilfe für Flüchtlingsprogramme war zwar versprochen, kam aber nicht an. So wohnten die Flüchtlinge in überteuerten Untermieten und wurden auf dem informellen Arbeitsmarkt ausgebeutet. Sie verdingten sich als Tagelöhner in der Landwirtschaft oder als Dienstboten. Ihre Kinder durften offiziell nicht in die Schule gehen. Familien, die bei ihrer Ankunft noch halbwegs wohlhabend waren, brauchten in dieser Zeit, Tag um Tag, ihre Ersparnisse auf.
Und so ist im Sommer 2015 der Punkt erreicht, an dem viele syrische Flüchtlinge in der Türkei keine Zukunft mehr sehen. Der Krieg in ihrer Heimat, wird ihnen klar, wird so bald nicht vorbei sein. Die Kinder müssen irgendwo wieder in die Schule gehen. Das letzte Geld ist bald weg. Und so kommen hunderttausende Menschen etwa gleichzeitig zu dem Schluss: Es reicht, wir gehen nach Europa!
Zwei Varianten gibt es für syrische Familien in jenen Tagen. Es ist eine Charakterfrage, für welche man sich entscheidet, doch sie wird weitreichende Folgen haben, bis heute. Die einen schicken jemanden voraus – meistens den Familienvater oder einen erwachsenen Sohn. Er soll die gefährliche Route über die Ägäis nehmen, sich nach Deutschland durchschlagen, einen Job, eine Wohnung finden und sich anschließend darum kümmern, den Rest der Familie nachzuholen – auf sicherem, legalem Weg, möglichst im Flugzeug.
Andere Familien sagen: Egal was passiert und egal wie gefährlich die Reise wird, wir fahren gemeinsam.
Wer sehen will, ahnt schon seit einigen Monaten, dass sich etwas anbahnt. Man sitzt im Railjet von Budapest nach Wien – mit Leuten aus Pakistan, die wahrscheinlich nicht kommen, um sich Schönbrunn anzuschauen. Auch an der Brenner-Grenze sind schon im Frühjahr viele Reisende unterwegs nach Deutschland, die anders ausschauen als die üblichen Touristen: viele junge Männer, einzeln oder in kleinen Gruppen, die meisten tragen nur eine Tasche mit ein paar Habseligkeiten bei sich. Aber man fragt nicht viel an den europäischen Grenzen. Es gilt ja das „Schengen“-Prinzip: keine Kontrollen.
Theoretisch gilt auch das „Dublin“-Prinzip: Demnach ist jenes EU-Land, das ein Flüchtling zuerst betritt, automatisch für das Asylverfahren zuständig. Aber Dublin ist in dieser Zeit de facto bereits abgeschafft. Dass die Flüchtlingsversorgung in Griechenland spätestens seit der Finanzkrise am Boden liegt, weiß man im Rest Europas schon länger. Wegen der unzumutbaren Zustände in den dortigen Lagern werden aus Österreich keine Rückführungen nach Griechenland mehr angeordnet. Doch nach außen hin wird das nicht laut gesagt. Man tut, als gälte Dublin noch und als wäre alles wie immer.
Schon im ersten Halbjahr 2015 haben tausende Flüchtlinge Griechenland verlassen und sich zu Fuß nach Norden auf den Weg gemacht, sie reisen durch Mazedonien, durch Serbien und weiter Richtung Ungarn. Und es kommen nach Griechenland stetig neue nach: An der türkischen Küste, gleich neben den Touristenstränden an der Ägäis, sind Sammelpunkte entstanden, wo Schlepper ganz offen ihre Dienste anbieten, Schwimmwesten und Schlauchboote bereitstellen und für die Überfahrt auf eine der griechischen Inseln Geld kassieren. In Kos, Lesbos, Samos gehen täglich einige hundert Menschen an Land. Staatliche Fähren bringen sie dann aufs griechische Festland.
Noch aber hat die westeuropäische Öffentlichkeit das Thema nicht so richtig auf dem Radar. Man spricht in diesem Sommer über die griechische Staatsschuldenkrise und die Frauen-Fußball-Europameisterschaft. Die Länder auf der Balkanroute versuchen, die Flüchtlinge so unauffällig wie möglich über die nächste Grenze weiterzureichen; sie beschleunigen ihre Durchreise, indem sie Busse und Züge bereitstellen. Nur Ungarn will dem anschwellenden Strom etwas entgegensetzen und kündigt an, an seiner EU-Außengrenze einen Grenzzaun hochzuziehen.
Das Buch „Flucht“ der Presse- Redakteure Christian Ultsch, Thomas Prior und Rainer Nowak zeichnet gut nach, wie aus diesen verschiedenen gleichzeitigen Dynamiken – Wegschauen, Beschleunigung, Abschottungsversuche – ein Sog entsteht, der immer mehr Menschen mitreißt. Flüchtlinge, die schon allzu lang in Lagern oder notdürftigen Unterkünften ausgeharrt haben, spüren: „Jetzt oder nie!“ Alle rundherum setzen sich in Bewegung. Wenn wir zu lange warten, fürchten sie, könnten wir übrig bleiben. Und irgendwann ist es zu spät.
Die Erschöpfung ist den Menschen anzusehen, die täglich am Hauptbahnhof und am Westbahnhof ankommen. Österreich ist im Ausnahmezustand. Man könnte auch sagen: Es mobilisiert seine besten Kräfte und zeigt, was es kann, wenn es will. An der österreichisch-ungarischen Grenze in Nickelsdorf wird über Nacht ein Empfangszentrum aus dem Boden gestampft: mit Decken, Essen, medizinischer Notversorgung, aber ohne Registrierung.
Von dort werden die Menschen nach Wien gebracht, mit Bussen, Sonderzügen, Taxis oder Privatautos. Am Westbahnhof hat die Caritas ein Versorgungsnetzwerk aufgebaut, an dem sich hunderte Freiwillige beteiligen – sie helfen bei der Essensverteilung, betreuen Kinder in einem eigens eingerichteten Kinderraum, stehen den Menschen mit Rat und Tat bei.
Am Hauptbahnhof, an der Hinterseite, dort, wo die Straßenbahn der Linie D unter den Eisenbahngleisen durchfährt, entstehen gleichzeitig selbstorganisierte Hilfsstrukturen. „Train of Hope“ heißt das komplexe, schillernde, basisdemokratische, unübersichtliche Wunderwerk aus privater Initiative. Es gibt eine Krankenstation, in der Ärztinnen und Ärzte erste Hilfe leisten. Es gibt Leute, die Kleider und Schuhe sammeln, sortieren und verteilen. Andere kümmern sich um Lebensmittelspenden und verwalten ein immer komplexer werdendes Lager, in dem von Bananen bis Haarshampoo fast alles angeboten wird. Andere nehmen Vermisstenmeldungen auf. Privatpersonen und Vereine bringen täglich Töpfe mit warmem Essen vorbei – am beliebtesten sind die Eintöpfe des Sikh-Kulturvereins.
Eine ganz besondere Rolle in dieser Zeit spielen österreichische junge Leute mit arabischer, persischer oder türkischer Muttersprache. Sie werden dringend zum Übersetzen gebraucht und erleben – häufig zum ersten Mal in ihrer Schul- oder Berufskarriere –, wie wichtig ihre Sprachkenntnisse sein können.
Die ankommenden Flüchtlinge allerdings sind völlig erschöpft. Viele von ihnen haben auf der strapaziösen Reise traumatische Dinge erlebt – sie waren in Seenot, wurden von Reisegefährten getrennt, sind in Panik, weil sie nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind; oder sie haben, speziell in Ungarn, körperliche Gewalt oder Demütigungen erfahren. Die meisten haben keinen Groschen Geld mehr in der Tasche. Viele sind am Ende ihrer Kräfte, haben wunde Füße – und wollen doch, ihr Ziel Deutschland so knapp vor Augen, weiter.
Читать дальше