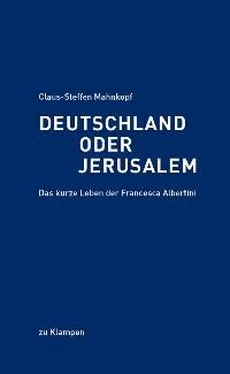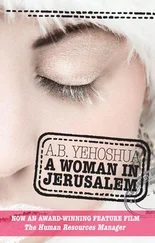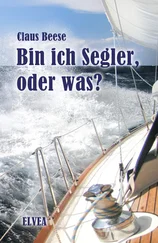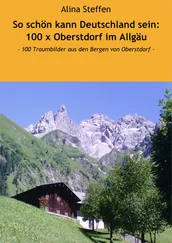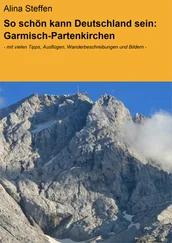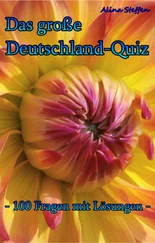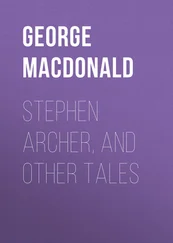Wie konnte das gutgehen? Ein Mann, dem die Religion fremd ist, eine Frau, für welche die Musik, ähnlich Kant, kaum mehr ist als reizvolle Proportionen, aber kaum einen Geist enthält? Es mag banal klingen: gerade deswegen. Wir ergänzten uns. Es klappte wunderbar, es war niemals wirklich ein Problem. Zumal sie, nicht einfach aus Liebe, sondern mit guten Gründen, meiner Musik Geist zumaß. Es war ja nicht so, daß Francesca nicht die großen Klassiker kannte. Aber sie war Verdianerin, ich Wagnerianer, wenn man das zuspitzen darf. Sie blieb hier Italienerin. Während meiner Zeit als Konsultant der Stuttgarter Oper bei deren Jahrhundert-Ring besuchten wir alle Premieren. Obwohl sie etwa die Siegfried-Inszenierung unter einem theatralischen Blickpunkt hoch lobte, war ihr der schwere, der blechlastige Ton dieser Musik wesensfremd, ohne daß sie sofort die Antisemitismuskeule schwingen mußte.
Francesca war musikalisch und hätte wohl gerne in der Jugend ein Instrument erlernt. Sie hatte eine schöne, sonore Altstimme, die sie aber aus Scham versteckte. Ich hatte sie immer wieder vergebens ermutigt, Gesangsunterricht zu nehmen. Francesca kannte unzählige Lieder auswendig und konnte die Texte rezitieren. Sie liebte, neben jüdischen Gesängen, vor allem die italienischen Cantautori, jene hochgebildeten italienischen politischen Liedermacher wie Fabrizio de André, Francesco de Gregori oder Francesco Guccini. Sie wollte über die »Kritische Theorie der italienischen Cantautori« einen Text für Musik & Ästhetik schreiben. Der italienischen Popmusik à la Ti amo von Eros Ramazzotti schämte sie sich hingegen. Francesca hatte Kontakt zu Künstlern: Für den in Rom lebenden Künstler Andrea Battantier schrieb sie einen Text, dieser widmete dem »child Francesca« ein Video über Konzentrationslager.
Musik mußte für sie mit Text oder Handlung verbunden sein. Als sie, die Freiburger Studentin, in ein akademisches Konzert gebeten und von mir über die Länge einer Mahlersymphonie aufgeklärt wurde, schob sie eine Krankheit vor. Daher liebte sie die Oper oder Chorgesang, so aus der Renaissance, die sie in meiner CD-Sammlung entdeckte. Bei Puccini schmolz sie dahin. Als sie in einer Kirche Thomas Tallis’ berühmte 40stimmige Motette Spem in alium hörte, war sie enthusiasmiert. An Opernabenden interessierte sie die Inszenierung mehr als die Musik. Wenn diese ihr nicht lag, konnte sie das Haus auch früher verlassen. Bei der Uraufführung von Klaus Hubers Schwarzerde in Basel konnte ich sie gerade noch aufhalten. Immerhin war Huber mein Kompositionslehrer und Francesca von seiner Erscheinung äußerst angetan. Aber für sie zählte der Inhalt, der Stoff mehr als die Musik.
Francesca liebte die Harfe. Immer wieder versuchte sie mich zu einer speziell ihr gewidmeten Harfenkomposition zu verführen. Ich wies sie auf den diatonischen Charakter dieses Instruments hin und daß dies mit meiner musikalischen Sprache schwer zu vereinbaren wäre – was sie aber nicht verstand. Ich solle nicht chinesisch reden, antwortete sie mir. Dabei hatte ich bereits ein Harfensolostück geschrieben. Sie wünschte sich jedoch ein eigenes, persönliches. 2010 überlegte sie sich ernsthaft, eine Handharfe zu kaufen und sich das Spiel autodidaktisch anzueignen. Hierzu vertiefte sie sich in eine Einführung in die Notenschrift. Sie entdeckte die dem Fünfliniensystem innewohnende Unregelmäßigkeit zwischen Ganz- und Halbtonschritten und beschwerte sich bei mir über solche Irrationalität, die ihr nur Zeit raube. Als ich erklärte, daß wir diesen Unebenheiten die Tonalität zu verdanken haben, erreichte meine Rede sie nicht mehr. Sie hatte bereits innerlich abgeschaltet. Von einer Harfe war nicht mehr die Rede.
Die Musik verband uns also nicht oder nur wenig. Doch die Gemeinsamkeiten waren überwältigend. Wir mochten nicht: Horoskop und Esoterik, Adlige, laute, lärmige Musik, extrem geschminkte Frauen, Kreuzfahrten (ich foppte sie, sie werde wohl kaum ablehnen können, wenn ich ihr eine Kreuzfahrt schenkte; sie drohte daraufhin mit Scheidung), teure Autos, Pelzmäntel, den Papstkult, Fußball, Scharlatanerie in der Kunstszene, die Postmoderne. Wir verachteten Westerwelle, amüsierten uns über den Freiherrn zu Guttenberg, Berlusconi verabscheuten wir. Wir mochten Bruno Ganz, Woody Allen, Venedig, Katzen, Kartoffeln (Francescas, der Italienerin, Lieblingsbeilage), Ironie, Bücher, Reisen, Politik, Philosophie, Theater, Museen. »Mein Leben besteht auch aus Literatur, Politik, Theater, Oper und Freunden«, schrieb sie einmal. Das war bei mir nicht anders. Regelmäßig fuhren wir nach Basel zu den Museen, in Berlin gingen wir in jede wichtige Ausstellung, in Rom sowieso.
Häufig verständigten wir uns über philosophische Metaphern. Zu unserer Hochzeit im September 1999 beschenkten wir uns gegenseitig. Ich bekam eine sechsbändige Aristotelesausgabe. Die Widmung: »Aristotelicamente, tu sei il ›sinolo‹ della mia vita!« »Aristotelisch gesehen, bist Du die Substanz meines Lebens.« Natürlich hatten wir intellektuelle Differenzen, etwa, was die Einschätzung von Derrida betraf. Er war für sie ein genialer Schriftsteller, aber kein genialer Philosoph, der Lévinas für sie war. In politischen Fragen trennte uns ihre Ungeduld. Sie wollte die Demokratie in China jetzt, das Elektroauto jetzt, die Abschaffung des Hungers jetzt, die Reform des Kapitalismus jetzt, die Überwindung revanchistischer Bewegungen in Europa jetzt. Es konnte ihr nicht schnell genug gehen. Immerhin las sie auf meine Anregung hin das eine oder andere politische Buch, das pragmatische und nicht nur prinzipielle Lösungen vorschlägt, so von Franz Josef Radermacher oder Jeffrey Sachs. Da für uns beide die Vernunft – und nicht etwa der Glaube oder die Ideologie – an erster Stelle stand, konnten wir uns rasch verständigen. Unterschiede ergaben sich aus der unterschiedlichen Lebenserfahrung, dem Alter, der Herkunft, Interessenlage, dem Geschmack und Temperament – mithin Allzumenschlichem. Aber einen Grunddissens gab es für uns nicht. Wir hätten ohne großen Konflikt ein Buch zusammen schreiben können.
Wer religiös ist, könnte sagen, daß Gott uns zusammengeführt hat. Aber nicht in dem einfachen Sinne, daß er die Liebe zweier Menschen stiftet; eher in dem, daß zwei füreinander bestimmt scheinen und der Zufall, der sie zusammenführt, keiner sein kann. Uns verband die messianische Idee. Es war ihr Thema. Nicht nur im Messiasbuch und in der entsprechenden Vorlesung, sondern insgesamt. Das gilt aber auch für mich, seit ich in den frühen Kindestagen mit gesellschaftlichen Revolutions- und Erlösungsthemen der 1968er Zeit geradezu vollgepumpt wurde und kaum anders darauf zu reagieren wußte, als mir einen idealen Staat auszumalen. Als ich zehn Jahre später Adorno und den Schlußaphorismus zum Messianischen Licht in den Minima Moralia entdeckte, war es wie eine Wiedergeburt. Auf eine neue Reflexionsstufe wurde mein latenter Messianismus weniger durch das Studium, so in Frankfurt, gehoben, als durch die Begegnung mit der Jüdin, die Francesca war. Es ist schließlich kein Zufall, daß ich eines Tages ein großes Chorstück mit dem Messiastext von Maimonides komponieren sollte.
Unsere Liebe ging bis zu einer Art siamesischer Verschwisterung. Mir fiel irgendwann auf, daß ich im Kreise meiner Leipziger Studenten nicht nur häufig über Francesca sprach, sondern das in einer Art und Weise tat, als ob sie eine allseitig bekannte Persönlichkeit sei. Wie Francesca andernorts über mich sprach, erfuhr ich erst später. Eine Kollegin von der University of Amsterdam schreibt: »Im Sommer 2001 traf ich sie wieder in Oxford, auf einem Sommerkolloquium in Yarton Manor. Ich erinnere mich klar, daß es Ihr Hochzeitstag war, und sie war so glücklich, von Ihnen zu hören und Blumen zu empfangen. Sie erzählte das der gesamten Gruppe und strotzte vor Glück. Es war offensichtlich, daß sie sehr stolz auf Sie war.« Ein Kollege in Potsdam schrieb ihr einmal: »Warum sagst Du mir nicht, daß Du einen so berühmten Mann hast? Ich dachte immer, Dein Mann ist einer jener Partner, die froh sind, wenn etwas Licht vom Gatten auf sie herabfällt und die mit tränennassen Augen im Auditorium sitzen, wenn der Gatte irgendwo geehrt wird. Bei euch wird das eher ein Spiegelungsverhältnis sein.« Francesca antwortet: »Du hast mich nie nach meinem Mann gefragt … Jetzt aber im Ernst: Ich bin auf meinen Clausi sehr stolz.« Aus Hawaii kam die Beobachtung: »Francesca hat Sie sehr geliebt und mit großer Bewunderung von Ihrem Talent gesprochen.« Jeder Witwer hört das gerne.
Читать дальше