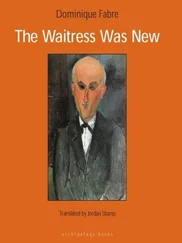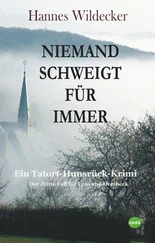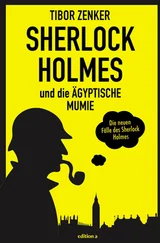»Sänk ju, gudbei«, verabschiedete ich mich von dem freundlichen Herrn der Fluggesellschaft. Dann saß ich auf meinem Koffer. Aus der Brusttasche meiner Jacke suchte ich eine Kippe und hoffte, mit warmem Rauch die Situation erst einmal zu überlagern zu können. Klickend sprang das Feuerzeug an, und ich lenkte, indem ich Daumen und Zeigefinger an der Spitze der Kippe hielt, die Flamme an den richtigen Punkt. Saugte den Rauch ein. Atmete aus. Und bemerkte, dass es ziemlich still war. Sicher, man hörte Autos, und ein Stückchen entfernt konnte ich durch die sich öffnenden Schiebetüren hindurch in unregelmäßigen Abständen das geschäftige Treiben des Flughafeninneren hören. Durch die schwere Luft zog sich immer wieder das Röhren startender Flugzeuge.
Aber um mich herum, in meiner Nähe, hörte ich niemanden.
Keine Stimmen, keine Gespräche, kein Geraschel.
Ich saß alleine auf meinem Koffer, um einen Bus zu bekommen, den ich nicht sehen konnte. Von dem auch niemand wusste, dass ich ihn bekommen wollte. Mich also auch nicht darauf hätte hinweisen können. Genauso gut hätte ich auf einer einsamen Insel darauf hoffen können, mein rettendes Schiff zu entdecken.
In solchen Momenten wird mir klar, dass ich auf eine ganz speziell beschissene Art von der Welt getrennt bin. Manches entgeht mir einfach. Manche Informationen, Zugänge, Möglichkeiten sind einfach nicht da. Und sind auch nicht alleine zu kompensieren.
Ich saß auf meinem Koffer und spürte, wie sich kühl und schleichend die Panik in mir breitmachte. Damals waren es noch viel mehr die murrende Stimme meines Vaters und die lächelnde Art meiner Mutter, die in mir sprachen, zu mir sagten: »Das ist nichts für dich, das habe ich ja gesagt!«
Während ich vor mich hin fluchte, mich verfluchte für diese beschissene Idee, fühlte ich deutlich, dass es jetzt verdammt nochmal um eine Entscheidung ging. Ich konnte entweder in Tränen ausbrechen und festlegen, dass ich einfach nicht fähig war, alleine zu reisen. Oder darauf vertrauen, dass es einen Weg geben würde, immer.
Während ich noch so hin und her überlegte, hörte ich das schwere Schnaufen des Busses. Und plötzlich war eine Stimme neben mir.
»Excuse me, which direction are you waiting for?«, fragte ein junger Mann.
»Oxford«, brachte ich gerade so heraus.
»All right, here you go.«
Die helle Männerstimme hatte schlanke Finger, mit denen der junge Mann mich jetzt zum Bus brachte. Der Bus roch warm und nach Polster und der Busfahrer sagte mir, dass er mir sofort Bescheid geben würde, wenn die richtige Haltestelle erreicht sei.
Ich setzte mich neben die helle Männerstimme. Als sein Handy vibrierte, konnte man dumpf durch seine Hosentasche Luke singen hören: »Do you want to see the world? Do you want to see the world? Do you want to see the world in a different way?« Der Song wurde unterbrochen, als er das Gespräch entgegennahm. Aber in meinem Kopf, da lief der Song weiter. Schrammelnd und jauchzend schraubte sich der Song vorwärts, während der Bus seinem Ziel entgegenrollte und mich durch England chauffierte.
Meinem Ziel entgegen, mich für Weltreisen und Reißaus nehmen vorzubereiten.
Meine Nebenhöhlen waren während der einstündigen Busfahrt wie von selbst abgeschwollen. Ich atmete tief ein. Hinter mir fuhr der Bus an, ich stand in der warmen Sonne, es roch leicht nach Stadt, die Vögel jubilierten. Ich hatte eine volle Ladung Euphorie abbekommen und winkte dem für mich unsichtbaren, aber hörbar schnaufenden Bus hinterher. Das lief alles ziemlich gut.
Eine kleine, etwas knubbelige Hand legte sich auf meinen Arm.
»You must be Johann, how nice to meet you.« Seine Stimme hatte ein leichtes Zittern, als ob er innerlich vibrieren würde, als wäre er furchtbar unsicher. Und mein Name klang eher wie »Jowhänn«. Nach der Begrüßung sprach er außerdem schnell, die Wörter zu einem langen, atemlosen Brei zusammenziehend. Ich verstand kein Wort. Aus seinem Mund roch es nach totem Tier. Ebenso vibrierend und schnell nahm er mich am Arm und brachte mich nach Hause.
Das kleine Häuschen, in dem die beiden wohnten, hatte ein wenig Rasen davor und war warm und herzlich wie seine Frau, der ich dort begegnete. Reihenhaussiedlung auf Britisch. Dass sie besser zu verstehen war als ihr Mann, beruhigte mich ein wenig. Irgendwie absurd war dabei, dass die kleine Lady im englischen Haus zwei künstliche Hüften hatte, und als ich meinen Hintern das erste Mal auf die Schüssel setzte, baumelten meine Beine in der Luft. So auf dem Wasserklosett für Menschen mit besonderen Bedürfnissen dachte ich darüber nach, was wohl ein Behindertenscheißhaus für Blinde sein könnte und musste lachen.
So kam also der blinde Physiotherapeut nach England und landete bei therapiebedürftigen Menschen.
Und zwar sehr netten Menschen. Ich bewohnte das Zimmer der mittlerweile ausgezogenen Tochter, das die beiden an Gaststudenten vermieteten.
Gast und Student, das war ich in Oxford. Bei der Familie war ich echter Gast, wurde betüddelt und bekocht. Das kann in England ja durchaus etwas anstrengend sein, aber die Dichte an Chips und Frittiertem hielt sich in Grenzen. Und der Rest war so, wie ich mir zumindest vorstelle, dass ein Studentenleben sein muss. Das mag ein bisschen klischeebeladen sein, aber da ist niemand gefeit vor.
Vier Stunden am Tag hatte ich Englischunterricht. Die übrige Zeit verbrachte ich mit fünf Menschen, die ich dort kennen lernte, meiner UK-Clique:
Da war die hübsche Koreanerin, die mit ihrem spitzen Lachen schnell mein gebrochenes Herz eroberte. Sie war witzig, wahnsinnig intelligent und mir an Fleiß und Charme haushoch überlegen. Ich stolperte in Internatsgewohnheiten und war schon wieder verknallt. Dann gab es einen Sportlertypen aus Heidelberg, der schneller die Nummer der Koreanerin hatte, als ich bis drei zählen konnte. Und einen etwas orientierungslosen Südtiroler, der ein wandelndes Musiklexikon war. Das Duo infernale der Truppe aber waren Carlo und Luca. Die beiden italienischen Jungs waren von Italien nach England ausgesandt worden, um die Klischees nicht nur am Leben zu halten, sondern sie für immer in Stein zu meißeln. Nie wieder habe ich so etwas Frauenfixiertes kennengelernt. Jede Frau wurde das Zentrum, um das sich das Streben und Reden und Denken der beiden Jungs mit dem sonnigen Akzent drehte. Außerdem rannten sie in jedes italienische Restaurant, um sich Pasta essend darüber zu beschweren, dass die Briten keine Pasta machen konnten.
Mit dieser Truppe machte ich Oxford unsicher. Von Café zu Pub, von Kneipe zu Konzert ziehend, fühlte ich mich so richtig Kooks, so richtig studentisch. Mit Bier bewaffnet genossen wir die Zeit an der Themse. Am Campus wurde man tagsüber mit Flyern überschüttet, freie Wahl, Musik und Drinks und lange Nächte.
Als das erste Wochenende anstand, beschlossen Carlo, Luca und ich, dass wir zwei Tage in London verbringen mussten. Als ich das meiner Gastfamilie erzählte, freuten sie sich. Die Lady des Hauses drückte mir mit kurzen, knubbeligen Fingern eine Digitalkamera in die Hand und sagte, dass ich Fotos mitbringen soll. Klar, kein Problem. Ich gab die Kamera weiter an Carlo und Luca.
London war ein Trip, den wir irgendwie zwischen Kultur und Absturz hineinorganisierten. Und der eigentlich für mich deswegen wichtig war, weil ich irgendwann am Ende eines Abends mit den Jungs in einem kleinen Rockclub landete, der uns endgültig fertigmachen sollte. Kurz bevor ich wusste, dass es nun schwierig werden würde, ohne Seegang einen Schritt zu machen, saß ich an der Bar. Der Laden dröhnte angenehm über mich hinweg, neben mir flirteten Carlo und Luca mit einer mit den beiden etwas überforderten, aber vom italienischen Flair überzeugten Lady. Ich wandte mich lächelnd von den beiden ab, drehte mich auf meinem Hocker ein und lauschte durch den Lärm hindurch, ob der Barkeeper in der Nähe war.
Читать дальше