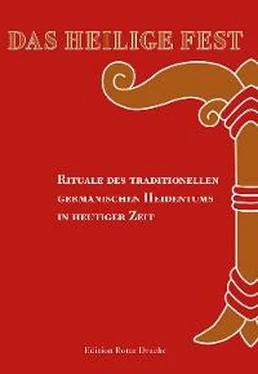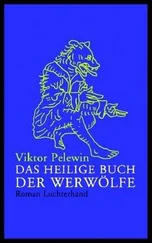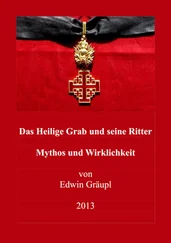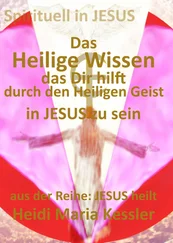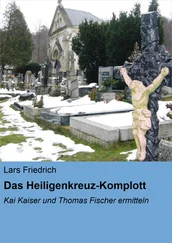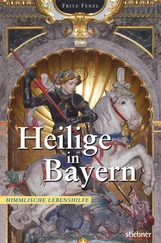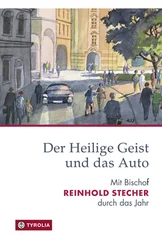Jede Kultgemeinschaft im VfGH wählt in eigener Verantwortung ihre Kultleiter, die ausschließlich für die Organisation und Durchführung der Rituale zuständig sind und keinerlei Lehrautorität oder Mittlerrolle haben. Sie heißen Blótmänner bzw. Blótfrauen . Die Begriffe goði und gyðja , die in manchen neuheidnischen Kreisen mystifiziert werden, werden im VfGH nicht verwendet.
Einen sehr wichtigen Platz in den heiligen Festen unserer Vorfahren nahmen mythische Gedichte und Lieder ein, die im Ritual als Anrufungen der Götter oder beim Festgelage zu ihrem Ruhm vorgetragen wurden. Nicht von ungefähr hängt das angelsächsische Wort für ein heidnisches Opfer, lác , mit dem mittelhochdeutschen leich (Melodie, Gesang) zusammen. Das hatte natürlich auch ästhetische Gründe, denn man wollte die Feste schön und würdig gestalten, ihnen durch Wohlklang und gewählte Worte Glanz verleihen und die Götter damit erfreuen und ehren. Alle bedeutenden Dinge wecken im Menschen das Urbedürfnis nach künstlerischer Gestaltung.
Es ist aber zugleich auch so, dass das Große und Wesenhafte selbst „gesungen werden will“, wie Walter F. Otto, der Sohn des bereits genannten Religionsforschers Rudolf Otto, über die religiöse Bedeutung der Dichtung bei den Griechen sagte, für die sie eine heilige Kunst war: „Der Geist des Gesanges gibt ihnen Kunde, von welcher Art die Götter sind. Denn er ist im Grunde ihre Stimme.“ Deshalb waren nicht Priester und Philosophen die religiösen Lehrer der Griechen, sondern die Dichter, deren besondere Sprache und Erzählweise, das ehrwürdige Wort des mythos zum Unterschied von der Alltagsprosa des logos , den Göttern nahe stand und ihren Werken Wahrheit und Gültigkeit gab. In der Dichtung sprach, wie auch Platon in seinem Dialog „Ion“ erklärt, nicht der Mensch, sondern die Gottheit, die den Dichter ähnlich erfüllt und zu ihrem Sprachrohr macht wie den Seher. Apollon, der Gott der Seher, ist auch der Gott der Dichter, in dessen Gefolge sich die neun Musen befinden, von denen die Dichter ihre Inspirationen empfangen.
Bei den Germanen ist diese hohe religiöse Bedeutung der Dichtung, die sich bei den Kelten im druidischen Rang der Barden niederschlägt und ein indogermanisches Urerbe ist, noch viel deutlicher, denn hier ist es der höchste Gott selbst, Odin, der sich um sie kümmert. Auf seinem dreifachen Weg zu Wissen und Weisheit, der mit dem Erwerb der Seherkraft durch das Opfer eines seiner Augen im Brunnen Mimirs beginnt und sich in der Findung der Runen durch sein Selbstopfer am Weltbaum Yggdrasil vollendet, nimmt er in der Mitte zwischen diesen Ereignissen viele Mühen und Gefahren auf sich, um den Met Odrörir zu gewinnen, der ihn zum Dichter macht und fortan die Dichter der Menschen inspirieren lässt. Auch er schenkt ihnen dabei eine besondere Sprache, die in der nordischen Tradition bezeichnenderweise „runisches Reden“ genannt wird. Sie gibt dem Geheimnis, altgermanisch rûna, Gestalt und lässt es lebendige Gegenwart werden. Deshalb ist die Dichtung wahr und deshalb will alles, was wahr und wesentlich ist, zur Dichtung werden.
Die poetische Gestaltung eines Rituals hat also nicht nur ästhetischen, sondern auch spirituellen Wert und sollte bei großen Feiern nicht vernachlässigt werden. Wenn sich passende Texte aus der Überlieferung finden lassen, ist es gut – ihre Zahl ist aber leider relativ gering, sodass wir ohne neue, selbst gedichtete Anrufungen und Lieder nicht auskommen. Traditionelle Formen wie der Stabreim und die nordischen Strophen bilden dabei eine ideale Anknüpfung an die historische Dichtung; es eignen sich aber, wenn sie im Geist der Tradition eingesetzt werden, auch moderne Metren und Reimformen oder rhythmische Prosa. Die große Bandbreite, die sich etwa in der Wikingerzeit innerhalb weniger Generationen entwickelt hat, lässt erkennen, dass die germanische Dichtung nicht auf starre Formen fixiert, sondern sehr flexibel und innovativ war. Auch Mythen und Heldenepen wurden immer wieder neu bearbeitet, sodass wir mit neuen Gestaltungen, solange der Inhalt stimmt, in guter Tradition stehen.
Rituale sind ebenso wie Mythos und Dichtung immer auch stark von Symbolen bestimmt. In beidem, der Dichtung wie dem Symbol, geschieht eine „Verdichtung“ der Realität und ihrer komplexen, oft undurchschaubaren Vielfalt zu einer signifikanten Einheit, die dennoch all das zum Klingen bringt, wofür sie steht. So zeigt der Mythos in einem einzigen, exemplarischen Ereignis das ganze Wesen einer Gottheit und die Heldensage im Schicksal einer einzigen Familie alles, was Schicksal bedeuten kann. Auch das Symbol unterscheidet sich vom „Signal“ im Sinn des Philosophen Ernst Cassirer dadurch, dass es nicht eins zu eins für eine einzelne Sache steht, sondern für einen ganzen Komplex an Bedeutungen.
Wir verwenden Symbole, um Vielfältiges und Vielschichtiges ausdrücken und erfahren zu können. Das beste Beispiel dafür sind die Runen, jede für sich ein Symbol für verschiedene heilige oder profane Bedeutungskomplexe, die in ihrem Aufeinandertreffen beim Loswerfen vielfältige Zusammenhänge enthüllen. Wenn wir sie im Ritual singen, sprechen wir diese Bedeutungen an. Auch die Kultgeräte, die wir verwenden, sind über ihren praktischen Gebrauch hinaus Symbole. So ist das Blóthorn Gemeinschaft mit Göttern und Mitfeiernden, Ehre für die Götter und Verbindung zu den Ahnen, der Kreis der Feiernden ist der Erdenrund, der Schutz der Umhegung und die zyklische Gestalt allen Seins, und im Kreisen des Blóthorns verbinden sich alle diese Bedeutungen.
Rituale sind somit im Wesentlichen symbolische Handlungen, die in ihrer Gesamtheit alles, was uns heilig ist, in verdichteter Form ausdrücken und erfahrbar machen, komprimiert die ganze Vielfalt unserer Religion enthalten und unserer komplexen Beziehung zu den Göttern und Ahnen eine klare, greifbare Gestalt geben. Symbolisch sind unsere Riten auch im landläufigen Sinn, dass sie notgedrungen „nur“ eine Geste sein können. „Die Gabe will stets Vergeltung“ kann ja nicht bedeuten, dass wir den Göttern ihre Segnungen gleich vergelten. Auch das größte Opfer ist gering im Vergleich zu den Geschenken, die uns die Götter geben. Es ist eine ehrende Geste, ein Symbol. Als solches aber enthält es alles, was wir an Ehre besitzen und den Göttern erweisen können.
Beachten sollte man in Ritualen auch die Bedeutung von Bäumen und Tieren, die in besonderer Beziehung zu bestimmten Gottheiten und Festen stehen. Grundsätzlich gilt, was auch noch Hermann Hesse wusste: „Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit.“ Für einige Bäume gilt das nach der germanischen Tradition aber ganz besonders.
Die Eiche nimmt dabei den ersten Platz ein. Eichen sind Kultstätten aller Götter, vor allem aber Thor geweiht. Bekannt ist die Donareiche, die das Stammesheiligtum der Thüringer war und vom Missionar Bonifatius gefällt wurde. Odins Bäume sind Esche und Eibe, die beide mit Yggdrasil verbunden werden: Die Edda nennt sie eine Esche, zugleich aber immergrün. Der Baum im Heiligtum von Uppsala soll eine Eibe gewesen sein. Alle diese Bäume eignen sich ganz besonders, um unter ihnen ein Ritual zu feiern. Als Baum bezeichnet die Edda auch die Mistel, die als Heilpflanze zu Baldur gehört, zugleich aber das Geschoss ist, das ihn tötet. Beim Julfest wird sie erneut zum Symbol seiner Wiederkehr.
Von den Tieren sind besonders die wichtigsten Tiere Odins zu nennen, Wolf und Rabe, die seine Begleiter sind, und das Pferd (Sleipnir). Die Gesellschaft von Raben bei einem Ritual ist ein sehr gutes Zeichen. Das Pferd ist auch ein heiliges Tier Freyrs, neben dem Schwein, das ihm und Freyja geweiht ist. Freyja allein gehört die Katze. Thors Tier ist der Ziegenbock, Nerthus gehört das Rind und Ostara der Hase. Die essbaren unter diesen Tieren eignen sich am besten für ein Opfermahl. Rabe und Pferd halfen den alten Sehern auch bei der Weissagung. Die genauen Methoden sind nicht mehr bekannt.
Читать дальше