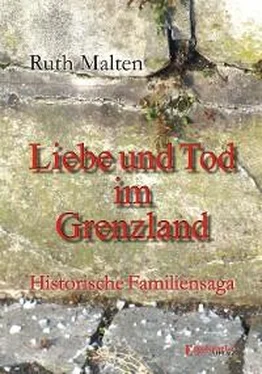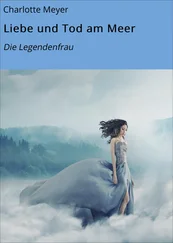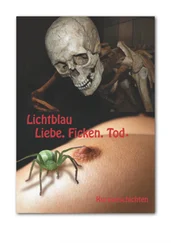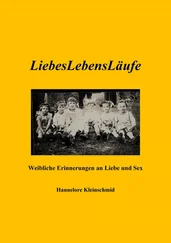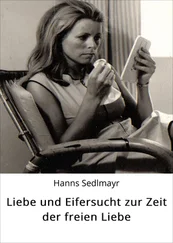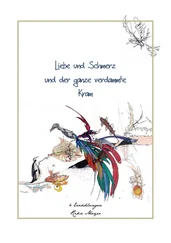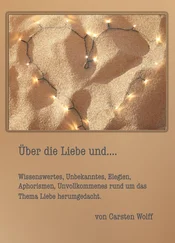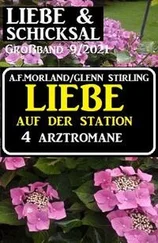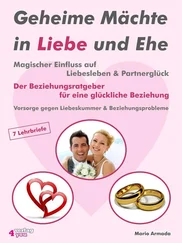Er sieht seine Mutter nach Luft schnappen, ihre Lippen öffnen und formen sich zu einer Aussage, er kommt ihr zuvor: „Wir wollen alle dabei sein. Wir wollen schneller zurück sein als unsere Großväter 1870/71. Etwas anderes kommt für uns nicht in Frage.“
Gustav schaut seinen Sohn an und überlegt, wäre ich in seinem Alter, würde ich ebenso denken und reden. In gewisser Weise ist er stolz auf seinen Großen, der in diesen Tagen erwachsen geworden ist.
„Habt ihr alles gut bedacht?“, fragt er dennoch. „Im Geschichtsunterricht haben wir das Für und Wider ausgiebig erwogen. Da wir aber siegen werden, lehnen die meisten von uns die Unkereien der ewigen Bedenkenträger ab.“
Hermine würde jetzt gern Arthurs Hand nehmen und ihn bitten, nicht zu gehen, einfach bitten. Aber da steht er, entschlossen, jung und stark, als wäre dieser angehende junge Krieger nicht ihr Sohn. Dennoch, sie ist aufgestanden, um näher bei seiner Hand zu sein, die sie sachte ergreift, und sagt, sehr leise und kaum hörbar: „Bleib.“ Arthur entzieht ihr seine Hand, behutsam aber entschieden. Entschlossenheit liegt in seinen Augen, aber auch ein Hauch von Wehmut. Er hat sich entschieden. Standfest muss er jetzt bleiben. Noch ahnt er nicht, dass er ein Leben lang nicht vergessen wird, wie er seiner Mutter in diesem Augenblick, Weh im Herzen, seine Hand entzog. Und die Ohnmacht in Mutters zusammensinkender Gestalt, ihre traurigen Augen. Er wird die Hand der Mutter vor Augen haben, wie sie wehrlos an ihrem dunklen, langen Rock niedersinkt. Und sich als elender Egoist fühlen.
Eine Woche später marschiert Arthur zusammen mit seinen Klassenkameraden unter Heil- und Freudenrufen der Bevölkerung durch die Stadt, eine kleine Militärkapelle begleitet sie und spielt: „ Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus …“ Frauen mit Blumensträußen begleiten sie und winken. Kinder laufen lebensfroh trällernd und Fähnchen schwingend nebenher. Paul drückt seinem großen Bruder ein letztes Mal die Hand. „Wenn ich gut sehen könnte und alt genug wäre, würde ich es auch als meine nationale Pflicht ansehen, für unser Vaterland zu kämpfen.“ Ernst und gefasst schaut er seinen großen Bruder durch seine kleine runde Nickelbrille an. Arthur bemerkt heut zum ersten Mal, dass Pauls Augen unterschiedlich groß sind. Das linke mit dem Kunstauge ist kleiner. Mitleid greift ihm ans Herz. Die Lippen seines kleinen Bruders zittern kaum sichtbar. „Mein Kleiner, red’ nicht so geschwollen. Pass du auf Mutter auf, das ist jetzt genauso wichtig“, sagt er und bemüht sich, stark zu wirken und nicht loszuheulen. Die Worte seines kleinen Bruders haben ihn mehr berührt, als er zugeben kann und Paul wissen soll. Die kleine Ilse kann gar nichts sagen. Sie umfasst Arthurs Hand mit ihren beiden kleinen Mädchenhänden und schmiegt ihr Gesicht in seine raue Jacke mit dem herbfremden Geruch des Uniformstoffes. Er streicht ihr über ihre blonden Rieselhaare. „Nicht flennen“, sagt Arthur leise zu Ilse. Und im Stillen energisch zu sich selbst.
Als der Zug abgefahren ist, sind Hermine, Gustav, Paul und Ilse sehr still geworden. Innerlich aufgewühlt halten sie sich an den Händen und trotten heimwärts.
Hermine fragt: „Wie kann eine solche Kriegsbegeisterung plötzlich, wie aus dem Nichts über ein ganzes Land kommen wie eine Seuche?“ Gustav, der in den zurückliegenden Tagen mit mehreren Geschäftsfreunden diese Frage erörtert hat, sagt: „So plötzlich kam das nicht. Spannungen gibt es seit längerem. Sie kommen aus Expansionsbestrebungen und unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Staaten.“
„Was heißt das konkret? Klingt mir zu abstrakt.“
Gustav erläutert: „Zwischen Deutschland und Frankreich schwelt ein alter Streit um Elsass-Lothringen. Beide erheben Besitzansprüche. Zwischen Deutschland und Großbritannien gibt es eine Rivalität um den Flottenausbau. Die Briten wollen die Nummer Eins auf den Meeren bleiben. Die Briten und Franzosen wetteifern trotz ihrer Entente cordiale, die sie äußerlich scheinbar versöhnt hat, um Ansprüche in den Kolonien.“ Hermine stellt das nicht zufrieden. „Wir leben doch aber nicht im Wilden Westen. Wofür gibt es Diplomaten, wenn alle plötzlich Lust haben, aufeinander einzuschlagen?“, sie hat sich ereifert und bekommt nur schwer Luft. Der Abschied von Arthur hat sie viel Nervenkraft gekostet: „Wir Deutschen sind überzeugt, anderen Nationen überlegen zu sein“, erläutert Gustav, „andererseits glauben wir, Objekt einer Einkreisungspolitik unserer Nachbarn zu sein, die Deutschland seine führende Rolle in der Weltpolitik verwehren will. Nationalprestige und Machtwille sind bei uns stark ausgeprägt. Wir wollen uns von den anderen nicht so ohne weiteres entthronen lassen.“
Hermine lässt nicht locker: „Also, ich hab bisher so viel verstanden: Die europäischen Staaten haben Spannungen untereinander. Es geht um Zugewinn an Land und Macht. Richtig?“ Gustav nickt. „Diplomatisch scheint nichts mehr zu gehen. Die Todesschüsse haben den ersten Domino-Stein zum Kippen gebracht. Erster Domino-Stein, das waren die Sarajewo-Schüsse auf das Kronprinzenpaar, der zweite das deutsche Ultimatum an Russland, mit der Mobilmachung aufzuhören, dem Russland nicht gefolgt ist. Deutschland erklärt den Russen den Krieg. Deutschland fordert Frankreich auf, neutral zu bleiben. Frankreich lehnt ab. Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. Die Bündnisverpflichtungen treten in Kraft und weitere Domino-Steine kippen.“ Hermine holt Luft. „Sind denn unsere Berliner Politiker, voran unser Kaiser Wilhelm, alle tollkühn geworden? Das kleine Deutschland gegen Frankreich und Russland gleichzeitig? Ein Zwei-Fronten-Krieg. Wie soll das gutgehen?“
In den nächsten Tagen ist in den Gazetten zu lesen, in Berlin sei eine große Ernüchterung eingetreten. Der Kaiser war sich offenbar über die zahlreichen Bündnisse nicht im Klaren. Er hat die vielfältigen Neutralitäts- und Waffenhilfe-Abkommen unterschätzt.
Gustav sieht nach der Zeitunglektüre ratlos aus. Das Blatt ist ihm unmerklich über die Knie auf den Boden gerutscht. Seine Brille hat er auf den Tisch gelegt. Er streicht sich mit der Hand durch sein Haar.
„Das kann ja heiter werden“, findet Hermine, zieht ihren Stuhl mit beiden Händen näher an den Tisch und legt, vornübergebeugt, ihre Ellenbogen kämpferisch auf die hölzerne Tischplatte: „Berufspolitiker, die einen Krieg anfangen, aber das Ganze nicht überschaut haben!“ Sie haut mit beiden Fäusten auf den Tisch, schüttelt verständnislos ihren Kopf. „Aber wir sollen unsere Söhne hergeben“, ihre Stimme wird lauter und schriller, „damit sie an der Front ausbaden, was die da oben mit ihrer vermeintlichen politischen Weitsicht und Erfahrung nicht überblickt haben. Haben wir dafür unseren Arthur groß gezogen?“ Sie schaut Gustav wild und böse an, als habe er sich den Krieg ausgedacht. „Gebe Gott, dass ihm nichts zustößt.“
Hermine sieht aus wie eine Furie. Ihre Haare sind in Unordnung geraten. Sie ist wiederholt mit den Händen hastig durch ihre Frisur gefahren. Ihr Körper bebt vor Zorn und Anspannung.
„Ich versteh dich ja“, sagt Gustav und will Hermine beruhigen, „denk an das, was Arthur beim Abschied gesagt hat und all die glauben, die nun jubeln und aus dem Häuschen sind: ‚In acht Wochen sind wir zurück, und ihr werdet stolz auf uns sein!‘“
Hermine schaut aus dem Küchenfenster und hat wieder ihren in die Ferne weisenden Blick, als sähe sie Dinge, die andere nicht sehen: „Hoffentlich behält er Recht zusammen mit all den anderen, die es ebenso sehen. Hoffentlich.“ Ilse sieht ihre Mutter ängstlich an, Paul blickt ratlos zu ihr auf, als könne sie ihnen die aufkeimende Angst nehmen. Gustav grübelt: ‚Meine eigene uneingestandene Euphorie‘, stellt er fest, ‚hielt so lange, wie wir unter den vielen Begeisterten am Bahnhof waren. Hier, allein mit den Meinen, hat klares Denken wieder eingesetzt. Mir schwant nichts Gutes. Und Hermine hat ihren ahnungsvollen Ausdruck in den Augen, als erblickte sie bereits kommendes Unglück.‘ Ihn fröstelt, obgleich draußen eine milde Augustsonne die Landschaft in ein warmes, goldenes Licht taucht. Am 04.08.1914 erklärt Kaiser Wilhelm vor dem Reichstag in Berlin: „… uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den uns Gott gestellt hat … Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche …“
Читать дальше