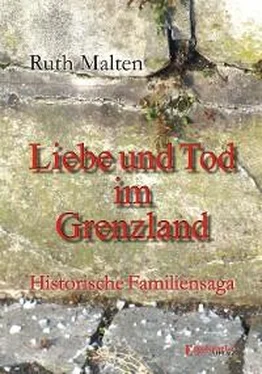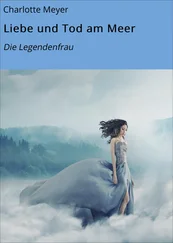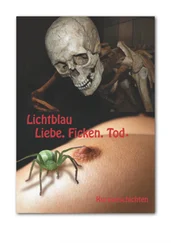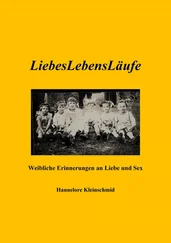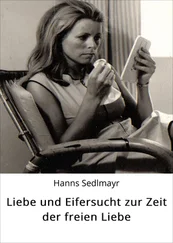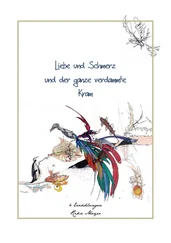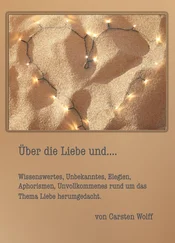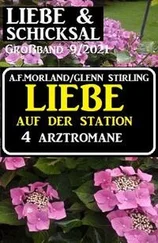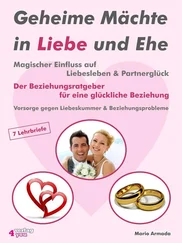Hermine ist es, als hörte sie Kriegslärm, Geklirr von Metall auf Metall, dumpfe Aufschläge, trockenharte Einschläge, dann qualvoll und peinigend einen Schrei, einen Schrei, wie von Arthurs Stimme: ‚Mutter, Mutter …‘ Hermine fährt auf. Habe ich geschlafen? Sie fühlt sich benommen, streicht mit der Hand über die Stirn, greift in ihren Nacken und streicht ihn wiederholt. Einen Moment lang fällt es ihr schwer, sich zu orientieren. Sie ist nicht sicher: ‚Habe ich geträumt? Oder bin ich eingenickt?‘ Vor sich undeutlich der offene Mund einer Frau, die auf sie einredet: „… werden doch ganz nass“, hört Hermine. ‚Meine lange aufgestaute Müdigkeit‘, geht es ihr durch den Sinn. Hat sie nicht Arthur schreien hören?
Eine dunkle Wolkenwand steht drohend über ihr. Zunächst dumpfes Donnergrollen, dann lautes Krachen. Erste dicke Regentropfen fallen auf die Zeitung wie harte kleine Steine. Ronja ist aufgeregt, sie hat Angst bei Gewitter, zittert und hat eine Pfote auf Hermines Schenkel gelegt. Sie jault und zerrt an der Leine, sie will nach Hause. Blitze zucken durch das Anthrazit des Himmels. Der Regenschauer verstärkt sich.
Hermine will mit Gustav und den Jungen reden. Sie hat keinen Regenschirm mitgenommen. Im Eingang des Cafes wartet sie den Schauer ab. Andere Cafe-Besucher stehen bereits schutzsuchend im Eingang. Hermine macht sich mit Ronja im Eilschritt auf den Heimweg. Noch grollt es hinter grauer Wolkenwand, von grellen Blitzen durchzüngelt.
Die Nachrichten überschlagen sich in den nächsten Tagen. „ Das Deutsche Reich ermuntert Österreich-Ungarn, gegen Serbien vorzugehen “, ist in der Zeitung zu lesen.
„Was heißt das?“, fragt Hermine ihre Söhne, die in der Schule über die gegenwärtige politische Großwetterlage reden. „Mein Geschichtslehrer“, sagt Arthur, „hält für möglich, dass es Krieg gibt, sagt aber gleichzeitig, das sei äußerst riskant, weil die Europäischen Staaten durch unterschiedliche Verträge so miteinander verbunden sind, dass eine Kriegserklärung, zum Beispiel von Österreich-Ungarn an Serbien, zu einem Flächenbrand führen könnte.“
„Was heißt Flächenbrand?“, fragt Hermine sehr leise und sorgenvoll. „Europäischer Krieg“, sagt Arthur behutsam, als glaube er das selbst nicht. „Hat er gesagt, muss aber nicht stimmen“, entgegnet Paul. „Hoffen wir, dass alle, die jetzt politisch Verantwortung tragen, die Nerven behalten“, stellt Gustav fest.
Am 31. Juli 1914 verkünden Extrablätter im deutschen Reich den allgemeinen Kriegszustand. Anfang August lässt Kaiser-Wilhelm II. die allgemeine Mobilmachung bekanntgeben.
8. Kapitel
Der erste Weltkrieg bricht aus
Am nächsten Vormittag geht es in der Klasse lebendig zu. Die Jungen drehen die Köpfe einander zu, fuchteln mit Händen und Armen, mit erhitzten geröteten Gesichtern reden sie aufeinander ein und sind lauter, als es Friedmann, ihr Geschichtslehrer, normalerweise erlaubt. Friedmann öffnet eines der hohen, vielfach unterteilten, weiß gestrichenen Fenster, um frische Luft hereinzulassen. ‚Hier stinkt’s wie in einem Raubtierzwinger‘, denkt er schmunzelnd, ‚kein Wunder, bei dreißig sich ereifernden, schwitzenden jungen Männern, die sich wie kraftstrotzende junge Löwen gebärden, gegenwärtig aber in viel zu engen, verkratzten Holzbänken, diese zu zweit miteinander verschraubt, wie eingeklemmt hocken. Das Ratschen der Schuhe auf dem Boden markiert den erhöhten Erregungspegel.‘
Krieg soll es geben, haben sie gehört. Hellwach sind sie alle geworden. Mitmachen? Na klar! Du spinnst wohl! Denk mal an die Folgen! Gedanken fliegen hin und her wie harte Tennisbälle. Das Thema hat sie entzündet. Keiner träumt heut den sanften Dämmerschlaf wie zuweilen, wenn von alten Römern oder Griechen die Rede ist.
Friedmann lässt seine Schüler frei ihre Gedanken und Gefühle benennen. Einige haben zu Hause über die Möglichkeit eines Krieges debattiert. Siegfrieds Großvater hatte gesagt: „Da gibt es nichts zu überlegen. Wenn ich nicht zu alt wäre, zöge ich sofort wieder mit wie 1870/71, als wir den Franzosen die Hucke versohlt und sie gescheucht haben wie die Hasen, und nur noch entfernt ihre roten Strümpfe von hinten blitzten. Ein Mordsspaß war das, kann ich dir sagen! Als wir heimkehrten, waren wir Helden, wurden bejubelt. Frauen hängten uns Blumenkränze um den Hals. Wie ein junger Gott hat sich jeder gefühlt! Die Menschen am Bahnhof umschwärmten ihre Helden. Auf den Händen trugen sie uns. In einer Woge von Stolz und Glück schwelgte unser Volk.“
Siegfrieds Augen strahlen, als sei er selbst dabei gewesen, er springt auf, während er gewichtig und begeistert die Worte seines Großvaters wiedergibt, sein Gesicht glüht wie im Fieber. Seine Mitschüler haben aufgehört, durcheinander zu reden und ihm stattdessen mit wachem Verstand vornübergeneigt zugehört. Manche bemerken nicht, dass sie mit offenem Mund schniefen und ihnen die Nase läuft.
„Siegfried, erzähl mal, wie es damals zur deutschen Kriegserklärung an die Franzosen kam“, fordert ihn Lehrer Friedmann auf. „Die Emser Depesche“, und was beinhaltete sie, hakt Friedmann nach? „In verkürzter Form die Forderung Frankreichs, das Haus Habsburg solle für alle Zeiten den Anspruch auf den Spanischen Thron aufgeben. Die verkürzte Form provozierte Frankreich, das daraufhin Deutschland den Krieg erklärte.“
„Und wie reagierten die Deutschen?“ Friedmann sah Arthur an: „Begeistert. Eine nationale Begeisterung lag in der Luft. Alle wollten mitmachen“, sagte Arthur. Friedmann hätte seine Schüler gern immer so geistesgegenwärtig wie an diesem Tag. Nachdenklich durchschreitet er den Mittelgang des Klassenzimmers, die Hände auf dem Rücken, den Kopf gesenkt, begleitet von den gebannten Blicken seiner Schüler. Auf seinem Rückweg sagt er bedacht, wie zu sich selbst, seine graumelierte wuchtige Haartolle in der Stirn: „Stellt euch vor, Österreich-Ungarn erklärt Serbien wegen der Todesschüsse in Sarajewo den Krieg. Was könnte passieren?“
Der lange, schlaksige, blondgewellte Hans ist der ‚Profi‘, und die unumstrittene Nummer Eins innerhalb der Klasse in Geschichte und Politik. Auch privat ein ernsthafter Wühler, lässt er nichts auf sich beruhen, was er nicht begriffen hat und liest alles, was ihm zu verstehen hilft. Durch seinen Großvater, Geschichtslehrer an einer Realschule, hat er einen vortrefflichen Gesprächspartner, was ihm zu einem Wissensvorsprung verhilft. Er meldet sich: „Nach dem Dreibund zwischen Österreich-Ungarn, Italien und Deutschland von 1882 ist Deutschland zu Waffenhilfe verpflichtet. Außerdem gibt es einen Vertrag zur Waffenhilfe zwischen Serbien und Russland aufgrund des Balkan-Bundes.“ Friedmann forscht weiter: „Deutschland beteiligt sich an dem Krieg gegen Serbien, was könnte weiter geschehen?“
„Russland könnte nach dem Eintritt Deutschlands aufgrund des nicht erneuerten Neutralitätsvertrages von 1890 in den Krieg gegen Deutschland eintreten. Da es außerdem ein deutsch-französisches Neutralitäts-Abkommen gibt, wären auch die Franzosen auf der Gegenseite dabei. Durch den Dreibund zu gegenseitiger Neutralität und Waffenhilfe verpflichtet, wären die Italiener auf der Seite der Deutschen. Über die britisch-französische Marine-Konvention sowie die Entente Cordiale die Briten auf der Gegenseite. Letztere verpflichtet beide gegenseitig zu Waffenhilfe.“ Hans hat sich in Rage geredet, und er ist außer Puste.
„Mann, Streber“, ist von Uwe zu hören, allerdings mehr anerkennend als abwertend, aber auch mit dem Unterton: ‚Wer soll sich das alles merken können?‘ Hans kennt das schon. Er zieht beide Schultern hoch, seine Stirn in Querfalten, legt seinen Kopf schief, schaut Uwe grinsend an und sagt: „Tja, Mann, nur kein Neid.“
Friedmann kann ein stillvergnügtes Schmunzeln nicht unterdrücken. Er muss bei einem Schüler wie Hans seinen Stoff sauber vorbereiten, sonst geht er unter. Guter Ansporn. Macht aber Freude. Mit halbwegs gestrenger Lehrermiene fährt er fort:
Читать дальше