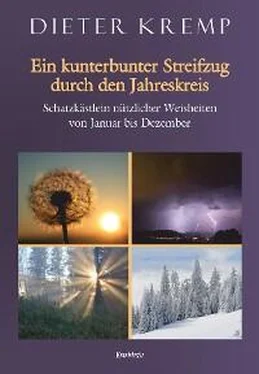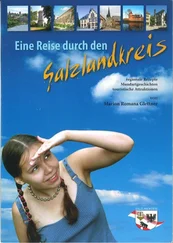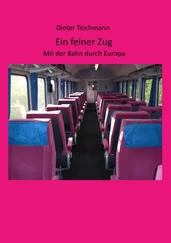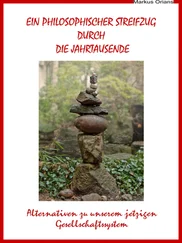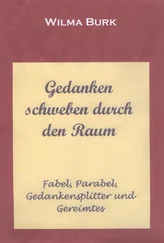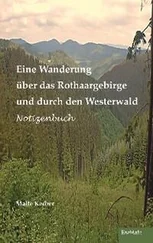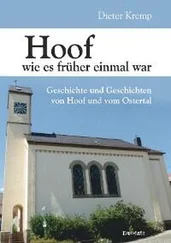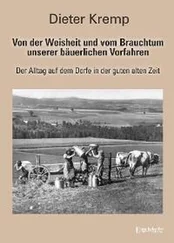1 ...7 8 9 11 12 13 ...30 Das „fleißige Handauflegen“ war ein viel gepriesenes Mittel bei Entzündungen im Kopfbereich. Der Glaube an Zauberei und Hexerei war noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Ostertal weit verbreitet. Das Handauflegen wird noch 1885 berichtet. So haben Marther Eltern ihre kranken Kinder nach Hoof gebracht, wo in der „Aacht“ eine 80jährige Frau das „Brauchen pflegte“.
„Beim Niesen soll man die Hände in warmem Wasser waschen, die Augen und Ohren und Fußsohlen mit den Fingern reiben.“ Das kitzelte wohl auch. Mag sein, dass der Reflex auf der Fußsohle, das Kitzeln in der Nase unterdrückte.
Bei Husten („Bettelmannshusten“) – worunter wir heute wohl die Lungenschwindsucht vornehmlich der armen Leute zu verstehen haben – wurde „viel Küssen“ empfohlen. Haben sich unsere Vorfahren daran gehalten, wird auch die epidemieartige Ausbreitung der Tuberkulose verständlich.
Gegen Schnupfen und Erkältungskrankheiten gibt es keinen Impfschutz, gegen die echte Grippe nur, wenn es sich um ein schon bekanntes Virus handelt. Doch Viren bedienen sich teuflischer Tricks, um den Abwehrmechanismus des menschlichen Körpers zu täuschen und zu hintergehen.
Es gibt wirklich typisches Grippe-Wetter: Nasskaltes, trübes, rasch wechselndes Wetter begünstigt das Entstehen von grippalen Infekten. Trockene Kälte behagt den Viren überhaupt nicht. Sonniges Winterwetter nimmt ihnen jegliche Chance der Verbreitung, und Sonne stärkt die Abwehrkräfte des Körpers.
Die Ärzte der Antike glaubten an einen „inneren Arzt“ im Menschen, an jene Selbstheilungskräfte, die uns davor schützen, dass die ständig aus der Umwelt in unseren Organismus eindringenden Krankheitserreger eine Krankheit auslösen. Sie wussten auch, dass Vorbeugen besser als Heilen ist. Ein sicheres Mittel gegen Erkältungskrankheiten ist die konsequent betriebene Abhärtung des Körpers das ganze Jahr über. Ausgedehnte Spaziergänge, Bewegungs- und Atemübungen an frischer Luft, regelmäßige Saunabesuche und eine vernünftige Vitamin-C-reiche Ernährung tragen dazu bei, den Körper zu immunisieren. Wer sich täglich morgens zu Wechselduschen durchdringen kann, hat auch einen wichtigen Schritt zur Vorbeugung getan: Drei Minuten so heiß wie erträglich, zwanzig Sekunden so kalt wie möglich – dreimal hintereinander. Ist die Erkältung trotz Abhärtung und Vitaminen nicht zu stoppen, sollte man nicht gleich mit „Kanonen auf Spatzen schießen“. Altbewährte Hausmittel und Heilkräutertees sind zumindest einen Versuch wert. Kamillen-Dampfbäder, heißer Holunderblütentee und Lindenblütentee in Verbindung mit einer Schwitzkur sind zu empfehlen.
Dazu nehme man Heilpflanzenpräparate zur Steigerung der Abwehrkräfte mit den Wirkstoffen des Sonnenhutes (Echinazin) und des Wasserdosts (Eupatorium). Zum frischen Verzehr empfehlen sich keimtötende Heilpflanzen mit natürlichen „Antibiotika“ wie Knoblauchzehen und Zwiebeln, Brennnesselblätter und Senfsamen, Meerrettich, Kapuzinerkresse und Gartenkresse. Menschen, die regelmäßig frischen Knoblauch essen – mindestens ein bis zwei Zehen pro Tag – erkranken selten an grippalen Infekten. Doch leben wir nicht auf dem Balkan, wo der äußerst penetrante Geruch, der noch stundenlang nach dem Verzehr vom Körper ausgedünstet wird, von den Umstehenden nicht wahrgenommen wird, weil er dort zu den „alltäglichen Gerüchen“ gehört.
SPINN- UND STRICKABENDE UNSERER VORFAHREN
Dornröschen fiel in einen hundertjährigen Schlaf, nachdem es sich mit der vergifteten Spindel gestochen hatte. „Was ist eine Spindel?“, würde heutzutage ein Kind fragen, dem man das Märchen vom Dornröschen erzählt.
In den Märchen spinnen die Königstöchter, in den Sagen die Göttinnen. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts gehörte das selbstgesponnene und selbstgewebte Leinen zum hochgeachteten Aussteuerschatz.
Spinn- und Strickabende gehören der Vergangenheit an. Erinnerungen an Spinnstuben und Bratäpfel werden wach. Die Bratäpfel brutzelten auf der heißen Ofenplatte. Aus der schwarzgebrannten Schale tropfte dicker, brauner Saft. Süßer Duft erfüllte den Raum.
Spinnen und Stricken waren die wichtigsten Winterarbeiten der Frauen. Zum ersten Spinnabend traf man sich in der Regel am letzten Donnerstag im November. Das konnte der Katharinentag sein. Die heilige Katharina ist die Patronin der Spinnerinnen. Und an Lichtmess (2. Februar) gingen auf dem Dorf die Spinnabende in der Regel wieder zu Ende. Zu den Winterarbeiten der Männer gehörten vor allem das Besenbinden und das Korbflechten.
In manchen Orten war es eine bestimmte Bäuerin, die die Spinnstube abhielt. In anderen Gemeinden wanderten die Spinnerinnen von einem Haus zum anderen. Man sparte in den Dörfern. Kerzen waren teuer, und auch das Petroleum war ein Luxus. Aber wenn man sich abwechselnd in einer Stube zum Spinnen, Singen und Spielen traf, dann konnte man in allen anderen das Licht sparen. Oft bildeten die Mädchen und Frauen der verschiedenen Jahrgänge Spinngruppen, die über die Winterarbeit hinaus zusammenhielten.
Die Spinnstube war auch eine „Erzählstube“. Beim Spinnen des Garns und beim Stricken der dicken Winterstrümpfe erzählten die Frauen Geschichten, Märchen und Sagen. Spinnstubenlidder wurden gesungen.
Meist trafen sich die Frauen am Nachmittag. Sie brachten Spinnrad, Flachs und Netzetopf mit, ein Wassergefäß zum Benetzen der Finger. Sie tranken zuerst Kaffee und aßen Kuchen, spannen dann bis zur Dämmerung. Zu Hause wurden dann Kinder und Vieh versorgt. Mit den Männern kehrten sie in die Spinnstube zurück. Wurst und Brot, Branntwein oder Bier standen als Spätimbiss bereit.
Junge Mädchen schwärmten in den Arbeitspausen auch gern aus, hielten heimlich Umschau nach ihrem Liebsten. Die jungen Burschen durften erst später kommen, brachten Dörrobst und gebackene Süßigkeiten mit.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spinnabende nach und nach zu reinen Strickabenden. Warme Pullover, Socken und Strümpfe für den Winter wurden gestrickt.
Was aber hat der alte Bauernspruch „Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, erquickend und labend“ mit der Spinne zu tun? Die Spinne kann gar nichts dafür, dass man ihr solche Sachen nachsagt. Die Bauern meinten einst, wer schon am frühen Morgen mit Flachs- oder Leinspinnen anfangen müsse, der habe Kummer und Sorgen, die es mit den Einnahmen aus dieser Arbeit zu bannen gelte. Am Abend zu spinnen bedeutete aber, dass man es sich gemütlich machen konnte, dass die Spinnerei eigentlich keine Arbeit, keine auf dringenden Gelderwerb gerichtete Beschäftigung war, sondern eine liebevolle Unterhaltung und Entspannung. Man konnte Sorgen und Kummer vergessen, Lieder singen, sich necken und vielleicht spann sich sogar manche Liebe an.
Nostalgische Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“! Kommt sie wieder? Auf jeden Fall ist Stricken wieder zur Mode geworden.
Unsere Vorfahren kehrten mit Besen („Hexenreisern“) die Winterunholde, bösen Geister und Dämonen aus dem Haus, und der gesellig wachsende Besenginster war im Mittelalter ein wirksamer Schutz gegen Hexerei. Seine harten, zweigähnlichen Stängel wurden auch als Kaminbesen genutzt, wodurch verständlich wird, dass die Hexen nach dem endgültigen Sieg des Frühlingsgottes über die Mächte der Finsternis auf einem Besen reitend das Haus durch den Schornstein verlassen: Hexennacht – Walpurgisnacht.
Einzelne Besenruten lagen früher auf dem Küchenschrank und die Buben hatten einen Heidenrespekt davor. Das war der Schlagbesen des Vaters, der damit den Ungehorsam der Kinder bestrafte. Doch die strafende Rute des Nikolaus war ursprünglich das Reis, das Symbol der Fruchtbarkeit, durch dessen Berührung mitten im Winter die Hoffnung auf das Licht der Sonne wachgerufen wurde. Das Reis war die Lebensrute.
Читать дальше