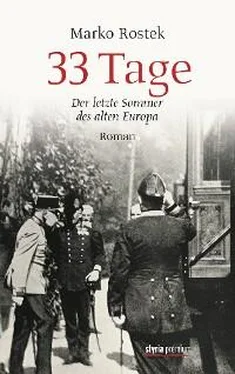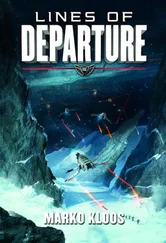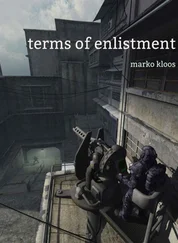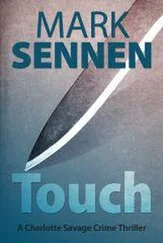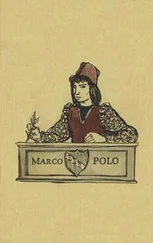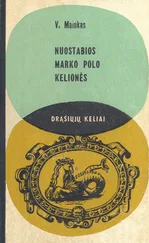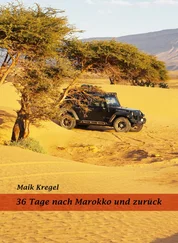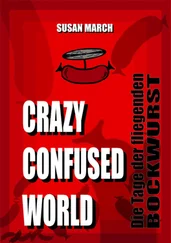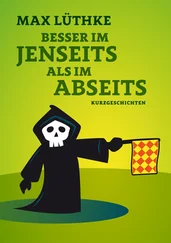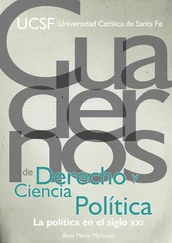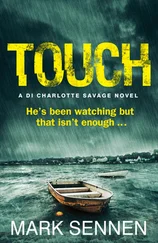Währenddessen ist Wilhelm aufgestanden und hat seine Gäste ermahnt, sich nicht von den Köstlichkeiten abhalten zu lassen, während er seine Aufmerksamkeit völlig auf die Dokumente zu richten gedenke. Jetzt geht er mit kleinen, vorsichtigen Schritten im Hintergrund des Speisesaals auf und ab und vertieft sich vollständig auf die beiden Schriftstücke, die er kontinuierlich umblätternd mit großem Interesse liest. Ab und an bleibt er stehen, um sich besser auf die Formulierungen konzentrieren zu können. Hoyos, ein wenig orientierungslos ob dieser unorthodoxen Vorgehensweise, blickt Hilfe suchend um sich. Als er sieht, dass der höchstrangige Offizier unter den Anwesenden ihm aufmunternd zunickt, ergreift Hoyos das Besteck und beginnt mit der Mahlzeit. Kaiser Wilhelm verliert er dabei keinen Moment aus den Augen. Wilhelm liest zuerst das Allerhöchste Handschreiben, dann das Memorandum, wie Hoyos bemerkt. Nachdem Wilhelm das Studium der Unterlagen beendet hat, bleibt er stehen, dreht sich zu Hoyos um, der augenblicklich aufspringt, und winkt ihn zu sich. Die Serviette auf den Tisch legend und hektisch den Stuhl nach hinten rückend, eilt Hoyos auf den Monarchen zu. „Ich“, beginnt der Kaiser und dreht sich mit dem Österreicher vom Tisch weg, „bin über die Inhalte der beiden Dokumente nicht überrascht und habe Mir aufgrund des schrecklichen Ereignisses, welches meinen lieb gewonnenen Freund Franz Ferdinand auf so entsetzliche Weise aus dem Leben riss, eine Reaktion auf das Attentat in dieser Art erhofft und erwartet. Richten Sie Seiner Majestät Kaiser Franz Joseph aus, dass Ich die Donaumonarchie unterstützen werde, auch“, Wilhelm hält inne und starrt Hoyos mit leicht zugekniffenen Augen an, „wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte. Heute Nachmittag habe Ich eine Unterredung mit Reichskanzler Bethmann Hollweg, dieser wird Ihnen morgen eine definitive Antwort überbringen.“ Hoyos ist überrascht. Auf eine derart klare Aussage hat er nicht zu hoffen gewagt, noch dazu ohne sein gänzliches Dazutun. Nach einem leisen „Jawohl, Euer Majestät“ und einer angedeuteten Verbeugung dreht sich Hoyos um und geht an seinen Platz zurück.
Nach dem Essen erweist Wilhelm II. seinen Gästen noch die Ehre eines gemeinsamen Digestives, bricht dann jedoch alsbald die Konversation mit dem Hinweis ab, dass der Reichskanzler für die angekündigte Unterredung jeden Augenblick eintreffen würde. Alexander Hoyos und die meisten der anderen Gäste werden von einem Hofbediensteten durch die Vorzimmer, Gänge und Treppen wieder zum Tor gebracht. Hoyos ist vom soeben Erlebten zutiefst beeindruckt. Die unkonventionelle Haltung des deutschen Kaisers ihm gegenüber, die unumwunden klare und deutliche Zusicherung, die Donaumonarchie zu unterstützen, sowie die Beiziehung des mächtigen deutschen Reichskanzlers zur Erörterung des österreichischen Anliegens verlangen ihm Respekt vor dem deutschen Führungsstil ab. „Und das alles“, er gerät bei diesen Gedanken ins Schwärmen und kann einen neidvollen Seufzer beim Vergleich mit dem Wiener Krisenmanagement nicht unterdrücken, „innerhalb eines Nachmittages, hier wird nicht lange gefackelt. Es scheint, als würde Wilhelm wissen, was zu tun ist!“
Am großen Tor angekommen, wird er aus dem Neuen Palais entlassen und wieder zurück auf die Straße geführt. Er hört das hinter ihm zufallende Tor und die sich rasch entfernenden Schritte des Wachpersonals. Seine Blicke suchen das Botschaftsautomobil, das er alsbald die Straße hinunter entdeckt. Der Fahrer steht gelassen an das Fahrzeug gelehnt und unterhält sich mit Passanten. Als er vor dem Tor die Straße überqueren will, muss er für einen Moment stehen bleiben, denn eine schwarze Limousine kommt zügig näher. Unmittelbar vor Hoyos reduziert der Fahrer seine Geschwindigkeit und biegt in Richtung Haupttor des Palais ab. Sich erneut dem Tor zuwendend, bemerkt Hoyos, wie zwei Wachebeamte aus dem Haus stürzen und die schweren gusseisernen Flügeltore auseinanderdrehen, um dem Wagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Während die Limousine wartet, erkennt der österreichische Sondergesandte den deutschen Kriegsminister Erich Falkenhayn und Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg im Fond des Wagens. Für eine nähere Bestimmung der anderen Personen, deren Silhouetten Hoyos ebenfalls wahrnimmt, reicht die Zeit nicht, denn der Fahrer nimmt sofort wieder Fahrt auf, nachdem die Tore geöffnet sind. Alexander Hoyos beobachtet, wie der Wagen die Auffahrt entlangfährt und, während die Gittertore wieder geschlossen werden, die Männer aussteigen und im Schloss verschwinden.
„Hm, Falkenhayn, Bethmann Hollweg und andere! Unsere Angelegenheit scheint von größter Wichtigkeit für Berlin, denn sonst wäre nicht die Reichsspitze vertreten.“ Hoyos blickt bei dem Gedanken noch einmal links und rechts, um danach schnellen Schrittes die Straße zu überqueren und zum Automobil zurückzueilen.
***
Kaum hat der Wagen vor dem Haupteingang des Palais gehalten, werden die Türen aufgerissen und die Insassen steigen aus. Der deutsche Reichskanzler erhebt sich mühsam und steigt unbeholfen hinter Falkenhayn aus dem Wagen. Kurz stehen bleibend blickt Bethmann Hollweg zurück zur Einfahrt, wo er gerade noch einen Mann erkennen kann, der flinken Schrittes die Fahrbahn überquert und dann seinen Blicken entschwindet. Ihm ist, als hätte er, während das Automobil kurz anhielt, vor dem Tor des Palasts den österreichischen Gesandten gesehen, der für den nächsten Tag bei ihm angekündigt ist. Bethmann Hollweg schiebt den Gedanken beiseite und stellt fest, während er sich langsam die Stufen zum Eingang aufwärtskämpft, dass der Kriegsminister und die anderen Begleiter bereits vorausgeeilt und im Palais verschwunden sind.
Der Reichskanzler fühlt sich müde, ausgezehrt und antriebslos. Der kurzfristige Stimmungsaufschwung, der vorgestern Abend bei ihm durch die kaiserlichen Randnotizen auf Tschirschkys Bericht eingetreten ist, hat nicht lange angehalten. Seine Stimmung hat bald danach wieder umgeschlagen. Durch den Tod seiner über alles geliebten Frau im Mai dieses Jahres hat sich sein bisheriges Leben, sowohl das private als auch das politische, mit einem Schlag relativiert. Schon vor dem tragischen Ereignis hat ihn die lange, schwere Krankheit seiner Frau immens belastet und seine ohnehin ausgesprochen pessimistische Grundhaltung, was die Lage des Deutschen Reiches im Allgemeinen und die Gestaltungsfreiheit seiner Regierungstätigkeit im Besonderen betrifft, zusätzlich verstärkt. Durch den Tod seiner Gattin hat eine Perspektivenlosigkeit und Leere von ihm Besitz ergriffen, mit der er nicht umgehen kann. Schließlich hat er sich vorgenommen, die Sommertage auf seinem Landsitz östlich von Berlin, fernab der politischen Weltbühne, zu verbringen, um seine angeschlagene Verfassung wieder ins Lot zu bringen. Was sein Privatleben anbelangt, so hat er die Hoffnung gehegt, dass sich die vertraute und stimulierende Umgebung auf seinem Gut positiv auswirken würde.
Was sein öffentliches Leben als Kanzler des Deutschen Reiches anbelangt, so hat er mit Erschütterung feststellen müssen, dass sich die innere Leere auch seiner Einstellung zur aktiven Gestaltung der Politik bemächtigt hat. Lustlosigkeit und völliger Verlust von Kompromissbereitschaft haben sich in seine Arbeitsweise eingeschlichen. Während seine außenpolitische Ausrichtung immer danach gestrebt hat, mit England einen friedlichen Konsens zu finden, sieht er jetzt darin keinen Sinn mehr. Die letzten Jahre haben zwar zögerliche Annäherungen mit der Weltmacht gebracht, aber nun tritt die politische und militärische Einkreisung des Deutschen Reiches im klarer vor seine Augen. Für seine Ziele hat er stets Kompromisse gemacht, in Marokko, in Persien, und noch zuletzt ist er dem englischen Sondergesandten Haldane weitestgehend entgegengekommen. Doch jetzt, im Banne der geänderten Wahrnehmung, ist es ihm möglich, sich einzugestehen, dass durch die britisch-russischen Flottenvereinbarungen des vergangenen Jahres seine Politik der Annäherung an England gescheitert ist. Das harte Ringen um die kleinen Schritte hat zu nichts geführt, jetzt ist damit Schluss. Seine persönliche Tragödie hat ihm klargemacht, dass die österreichisch-ungarische Monarchie aus dieser Einkreisungspolitik als letzter und wichtigster Verbündeter hervorgetreten ist. Daher begreift er die Nachricht aus Sarajevo, die ihn auch auf seinem Landsitz erreicht hat, als Chance für Deutschland, aus dieser Umklammerung auszubrechen und Weltmachtpolitik ganz nach der Spielart seines Kaisers zu betreiben.
Читать дальше