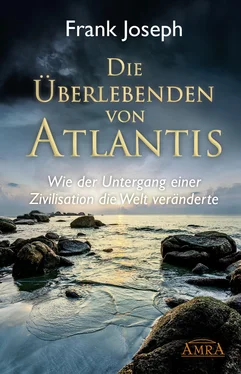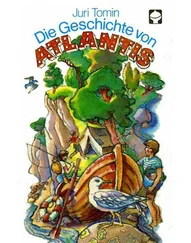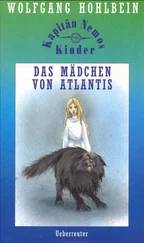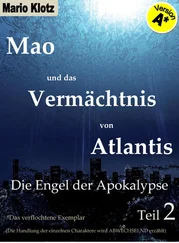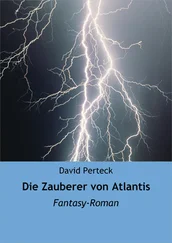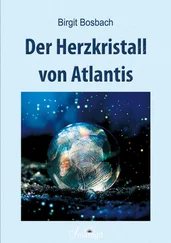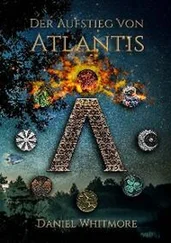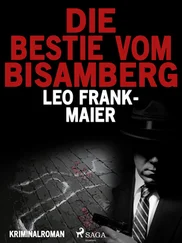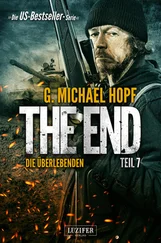Zur gleichen Zeit listete der hethitische Großkönig Tudhaliyas IV. für seinen königlichen Verbündeten im Amurri-Reich auf Zypern seine eigene Koalition auf: »Die Könige, die mir gleichrangig sind, sind der König von Ägypten, der König von Babylon, der König Assyriens und der König von Ahhiyawa [Homers Achaia, das mykenische Griechenland].« All diese Kämpfer wurden nun für eine internationale Konfrontation aufgestellt, und noch nie hatten sich so viele verschiedene Armeen und Flotten über so große Entfernungen hinweg versammelt.
Die Mykener hatten weitaus weniger Erfolg damit, die anderen Griechen davon zu überzeugen, dass ein universelles Bündnis notwendig war. Dafür sprachen allerdings die Umtriebe trojanischer Freibeuter (gegen die auch die Mykener nicht immun waren), deren Verwüstungen sich auf den gesamten Peloponnes auszudehnen begannen. Es gab außerdem beunruhigende Nachrichten aus Troja selbst. König Priamos hatte gerade ein intensives Schiffsbauprogramm gestartet. Seine Untertanen waren führend in der Herstellung von Segeltuch und der Produktion von Pech, und ihr Land war ungewöhnlich reich an Wäldern und Bauholz. Die Mykener schlossen daraus, dass eine Invasionsflotte gegen sie vorbereitet würde, und es kam zu einem Wettrüsten der Seestreitkräfte.
Inmitten dieser Umtriebe könnten trojanische Piraten zu weit gegangen sein, absichtlich oder zufällig, als sie eine königliche Person gefangen nahmen, vielleicht eine Frau namens Helena. Ihre Entführung könnte der Propaganda-Akt gewesen sein, der die zerstrittenen Griechen einte. Keine geringere Autorität bezüglich der Ereignisse jener Zeit als der renommierte Lionel Casson vermutet, dass die »Entführung« Helenas tatsächlich der Funke war, der das Pulverfass zum Explodieren brachte. Sie war zumindest ein zugkräftiges Symbol für die Verluste, die Mykene durch trojanische Piraten erlitt. Angesichts des Charakters jenes Zeitalters ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass eine griechische Prinzessin während eines der zahlreichen Akte der Piraterie, die damals in der Ägäis vorkamen, geraubt wurde.
Die Entführung eines Mitglieds des königlichen Hauses wäre sicher Grund genug für einen Krieg zwischen zwei Völkern, deren Beziehungen auf Messers Schneide stehen. Vielleicht war es auch ein bewusster Akt der Trojaner, um eine entscheidende Konfrontation zu provozieren. Was auch immer das Motiv war, die Mykener zogen alle verfügbaren Schiffe zusammen und versammelten alle Krieger von Pylos bis Phillippi für einen waghalsigen Erstschlag. Dies war mit Sicherheit die richtige Entscheidung, weil die Trojaner dadurch nicht nur vom Zugang zum Meer abgeschnitten wurden, wodurch ihre Flotte wertlos wurde, sondern sie auch gezwungen waren, für die Dauer des Konflikts defensiv zu kämpfen. Im Jahr 1237 vor Christus überquerten griechische Streitkräfte in großer Zahl das Ionische Meer, um an mehreren wichtigen Punkten entlang der Westküste Kleinasiens zu landen und Troja von aller Hilfe von außen abzuschneiden. Sie begannen sofort, die Hauptstadt zu belagern. Ab dem ersten Tag des Krieges lag der Vorteil bei den Eindringlingen. Sie besiegten nacheinander König Priamos’ anatolische Verbündete und bereiteten anschließend einen großen Angriff auf Ilios vor (siehe Abb. 1.3).
Angesichts der griechischen Seestreitmacht im Norden und der ägyptischen Marine, die im Süden zum Einsatz bereitstand, wollten die atlantischen Admirale es vermeiden, ihre Flotte in eine so offensichtliche Falle zu lenken, gleichgültig, wie verzweifelt die Situation für ihre anatolischen Verbündeten war. Sie warteten also ab, ob eine trojanische Gegenoffensive die Umzingelung des Feindes durchbrechen und die Mykener zurück ins Meer treiben würde, wo sie sich leichter angreifen ließen. Die Hethiter auf der anderen Seite des belagerten Ilios warteten ebenfalls ab. Auch wenn sie die Seevölker fürchteten und auf ihre Vernichtung hofften, trauten sie Ägypten nicht, denn sie wussten, dass ein endgültiger Showdown mit dem Pharao – Vertrag hin oder her – unvermeidlich war. Die Ägypter ihrerseits hielten ebenfalls Abstand und begnügten sich damit, Getreide und Waffen an ihre unsicheren Verbündeten in Kleinasien zu schicken. Die Hethiter beschlossen, alle Gegner gegeneinander auszuspielen, bis sich eine günstige Gelegenheit zur Intervention ergeben würde. Wenn die Mykener sich überlegen zeigten, würden die Hethiter Ilios erobern, um zu verhindern, dass es an die Griechen fiele. Und wenn die Trojaner die Oberhand gewönnen, würden die Hethiter Troja besetzen, bevor die Seevölker in Kleinasien Fuß fassen konnten. In der Zwischenzeit bestand die beste Strategie wohl darin, allen Seiten zu erlauben, sich durch gegenseitiges Abschlachten zu schwächen, während sie ihre eigene Kraft für den entscheidenden Moment des Eingreifens aufsparten.
Dieser Moment schien gekommen zu sein, als sich die atlantische Hoffnung auf einen trojanischen Ausfall erfüllte: Ein Streitwageneinsatz durchbrach von Ilios aus die feindlichen Linien und bedrohte die Flotte der Griechen. Viele Schiffe gingen in Flammen auf. Die Mykener wurden zunächst ins Meer zurückgedrängt, sammelten sich jedoch wieder und begannen eine verzweifelte Gegenoffensive, so dass die Trojaner sich schließlich unter schweren Verlusten hinter ihre sicheren Stadtmauern zurückziehen mussten.
Während das eigentliche Ziel der Operation – den Feind an der Küste von weiteren Versorgungsmöglichkeiten abzuschneiden – nicht erreicht wurde, waren die Griechen doch zutiefst erschüttert, da sie während der Schlacht um ihre Schiffe der Vernichtung nur knapp entgangen waren. Die Verluste und die Erschöpfung der Griechen ausnutzend, griff die atlantische Flotte nun plötzlich an und durchquerte mit hoher Geschwindigkeit überall dort die Linien mykenischer Kriegsschiffe, wo sie nur dünn verteilt waren. Die Schiffe wurden in Schach gehalten oder versenkt, während Truppen der Seevölker erfolgreiche Landungen entlang der anatolischen Küste unternahmen. Eine ganze Armee – zehntausend Marineinfanteristen – ging unter dem wilden Beifall ihrer lydischen Verbündeten an Land. Sie wurden von Memnon angeführt, einem großen und kraftvollen Mann. Allgemein waren die Atlanter bekannt für ihre mächtige Statur, so dass die griechischen Mythen sie als »Titanen« bezeichneten.

Abb. 1.3. Die schrägen Verteidigungsmauern von Ilios, der Hauptstadt Trojas. Der Trojanische Krieg, der hier stattfand, war eigentlich nur eine lokale ägäische Phase der atlantischen Invasion der mediterranen Welt, wie sie von Platon beschrieben wurde.
In den Posthomerica wird Memnon als ein König aus Äthiopien beschrieben. Äthiopien wurde in früh- und vorklassischer Zeit mit den atlantischen Küsten Nordwestafrikas sowie mit dem atlantischen Reich im Allgemeinen assoziiert. Erst Jahrhunderte später wurde der Name »Äthiopien« einem Land südlich von Ägypten zugeordnet (siehe Joseph, Der Untergang von Atlantis , viertes Kapitel, Abschnitt »Der Strahlende«). Ovid beschreibt im vierten Buch seiner Metamorphosen , dass Prinzessin Andromeda in Äthiopien an eine hohe Klippe mit Blick auf das Meer gefesselt wurde – in dem Gebiet, das wir heute als Äthiopien kennen, wäre das nicht möglich gewesen. Andere Elemente des Andromeda-Mythos beschreiben nicht nur die Grenzen des Landes zum Ozean hin, sondern enthalten auch erkennbare atlantische Themen. Andromeda war die Urenkelin Poseidons, des Schöpfers von Atlantis. Dieser verwüstete die Küsten Äthiopiens mithilfe eines Ungeheuers, das Ovid als »vulkanisch« beschreibt, was auf Tsunamis hindeutet, die vom vulkanischen Berg Atlas ausgingen. Ein anderer römischer Gelehrter, Plinius der Ältere, gibt an, dass Äthiopien ursprünglich als Atlantia bekannt war. Memnon sagt von seiner frühen Kindheit: »Die Hesperiden zogen mich weit entfernt am Strom des Okeanos auf.« Die Hesperiden waren Atlanterinnen, Töchter des Atlas, die den heiligen Baum mit goldenen Äpfeln in der Mitte seines Inselreiches bewachten. Dass Memnon von ihnen »aufgezogen« wurde, zeigt, dass er in der Tat ein König war, ein Mitglied des königlichen Hauses von Atlantis. Nach seinem Tod wurde er von einer anderen Gruppe von Atlanterinnen betrauert, den Plejaden, Töchtern der Meeresgöttin Pleione und des Atlas.
Читать дальше