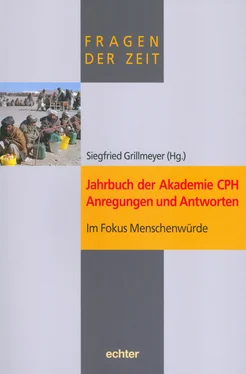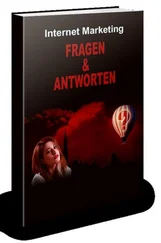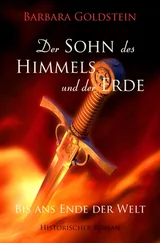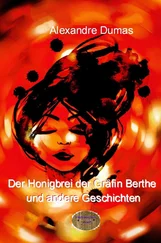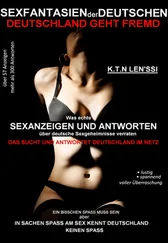1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Die Möglichkeiten sind gegeben. Um ein Land aufzubauen, benötigt man hunderte Milliarden von US-Dollar. Diese Gelder bekommen wir sicher nicht von Konzernen und sicher nicht von Ländern, die bei ihren Investitionen keine Fragen zur Regierungsführung stellen. Eines Tages sind die Rohstoffe eines jeden Landes zu Ende. Dann stellt sich heraus, wer für die Zukunft geplant hat. Ansonsten verharrt das Land in Armut und Rückständigkeit. Wer möchte das seinen Nachfahren zumuten?
Der Reichtum Guineas ist sein Fluch. Solange es Guinea nicht aus eigener Kraft schafft, sich von den Fesseln der großen Konzerne und der Industrieländer zu befreien, gibt es keinen Wohlstand für die Bevölkerung. Die Industrienationen sind nicht an einem wirtschaftlich starken Guinea interessiert, ein armes Land kann man viel leichter am Gängelband führen. Das Wohl der Menschen zu fördern und die Wahrung der Menschenrechte ist bei vielen Politikern nur ein Lippenbekenntnis, in Wirklichkeit wird nur daran gearbeitet, die Menschen in Guinea als Sklaven der Industrienationen zu halten und den Zugang zu billigen Rohstoffen sicherzustellen.
Präsident Barack Obama rief in seiner Rede beim UN-Millenniumsgipfel in New York die Entwicklungsländer zu mehr Eigenverantwortung auf. Wörtlich sagte er: „Für Ihre eigene Führungsverantwortung gibt es keinen Ersatz: Nur Sie selbst können jene schwierigen Entscheidungen treffen, die den Weg für eine dynamische Entwicklung Ihrer Länder öffnet.“
Otto Böhm
Freie Rede auch für Hassrede?
Zur Diskussion um die Einschränkung des Menschenrechts auf Meinungsfreiheit 1
Wer sich heute in Deutschland „gegen Rechts“ positioniert, tritt häufig zugleich auch für eine umfassende Bekämpfung der Meinungen von Neonazis – auch mit juristischen Mitteln – ein. Wer sich als Teil der internationalen Menschenrechtsbewegung versteht, verteidigt dagegen eher die Meinungsfreiheit gegen Einschränkungen. Diesen Zwiespalt sehe ich auch in Nürnberg: Die „Stadt der Menschenrechte“ führt zugleich die „Allianz gegen Rechtsextremismus“ an. Ich möchte heute Abend beide Grundhaltungen, die in Nürnberg jeweils eine breite Basis haben, detaillierter aufeinander beziehen.
Muss sich die Öffentlichkeit an Hasspredigten – im Englischen ist der Begriff Hate Speech gängig geworden – gewöhnen? Im Unterschied zu Hate Speech in den USA wird in Deutschland Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt. Die komplexen Argumentationen um das hohe moralische Empörungspotenzial und um die Rolle einer ständig alarmbereiten Medienwelt – die Medien als Moralisierungsanstalten, die selbst vom ständigen Tabubruch leben – können hier nicht entfaltet werden. Mir geht es nur um eine Frage aus diesem Diskursfeld: Soll das Recht auf Meinungsfreiheit eingeschränkt werden, wenn Aussagen und Behauptungen zum Hass gegen Minderheiten aufstacheln und an den Rassismus der Nazis anknüpfen? Und ich will darlegen, wie diese Problematik in verschiedenen Menschenrechtsgruppen diskutiert wird. Denn: In diesen internationalen Arbeitszusammenhängen ist es äußerst umstritten, die Meinungsfreiheit für rassistische Äußerungen einzuschränken. Dabei stoßen eine eher deutsch-kontinentaleuropäisch geprägte und eine eher angelsächsische Tradition aufeinander. In der Perspektive der zu schützenden Werte formuliert: Gleichbehandlungsgebot und Antidiskriminierungsschutz oder uneingeschränkte Freiheit des öffentlichen Ausdrucks?
Die Menschenrechte wollen gleichzeitig Meinungsfreiheit und Diskriminierungsfreiheit garantieren
Die Spannung ist in den Menschenrechten selbst angelegt: Das Verbot der Rassendiskriminierung zieht sich wie ein roter Faden durch den Menschenrechtsschutz. Die Bekämpfung rassistischer Äußerungen – als eine Vorstufe der Diskriminierung – wirft die Frage nach den Grenzen der Meinungsfreiheit auf. Denn es scheint widersinnig, Diskriminierungsverbote aufzustellen und gleichzeitig zu dulden, dass zur Ungleichbehandlung der Menschen auf der Basis ihrer ethnischen Herkunft aufgerufen wird. Aber zwischen den Werten Freiheit und Gleichheit gibt es ja nicht nur eine Spannung, sondern auch einen inneren, positiven Zusammenhang: Das universelle Gleichheitspostulat schützt auch die Freiheit und die Würde des Einzelnen. Weniger abstrakt: Im Deutschland der Dreißiger-Jahre haben sich rassistische Ideologien ja nicht nur gleichheits-, sondern auch freiheitsfeindlich gezeigt: Sie nahmen den Einzelnen ihre Handlungs- und Entwicklungsfreiheit.

Straßentheateraktion „Amnesty überfällt die Stadt“ der Erlanger Hochschulgruppe von Amnesty International, Juli 2009 (Bildnachweis: Fotograf: Cornelius Wachinger. Copyright: Amnesty-Hochschulgruppe Erlangen)
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 wollte ein möglichst universeller, das heißt, nicht an geographische oder historische Kontingenzen gebundener Codex sein. Der Geltungsanspruch sollte über jede nationale Beschränkung hinausgehen. Aber ihre Genese ist doch spezifisch; die Rechte sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind das Ergebnis eines Lernprozesses, den Rainer Huhle, der die Geschichte der Menschenrechte erforscht, so beschreibt: „Was hat die Welt also aus den Naziverbrechen gelernt? Das Beispiel der Meinungsfreiheit zeigt, dass dieser Lernprozess ein sehr heterogener war. Die Erfahrungen des Nazismus waren nicht überall gleich, und sie trafen auf unterschiedliche, bereits auf weiter zurückliegenden historischen Erfahrungen gegründete rechtliche und politische Traditionen“ (Huhle 2008, S. 123).
Nach 1945 haben sich Völkerrechtler aus ihrer je eigenen Tradition am Problem der Einschränkungsdefinitionen für die Meinungsfreiheit immer aufs Neue abgearbeitet. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte selbst schränkt die Meinungsfreiheit nicht ein. In Art. 19 des 1966 von den Vereinten Nationen beschlossenen Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) hat man sich auf folgende Formulierung geeinigt:
„(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit. […] (3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit“ (Bundeszentrale: Menschenrechte 1999).
Bestimmte Dimensionen der Einschränkung sind den sozialistischen und „Drittweltländern“ geschuldet. So wollte schon 1948 die Sowjetunion in der Allgemeinen Erklärung die Kriegspropaganda nicht unter den Schutz der Meinungsfreiheit gestellt sehen. Auch die Völkermord-Konvention von 1948 hatte die „Aufstachelung zum Völkermord“ als eine den Völkermord vorbereitende Handlung verboten. Und drei Jahre zuvor, vor dem Internationalen Militärtribunal von Nürnberg, war der fränkische NS-Propagandist Julius Streicher wegen dieses Delikts zum Tode verurteilt worden.
Gegenwärtig werden die möglichst engen Grenzen einer Einschränkung am deutlichsten von Agnes Callamard, Direktorin der Menschenrechtsorganisation „Article 19“, formuliert. Jede Einschränkung sollte den folgenden Anforderungen genügen: „klare und enge Definition; keine Bestrafung für Aussagen, die wahr sind; Bestrafung erst, wenn gezeigt ist, dass Hate Speech die Absicht hatte, zu Feindseligkeiten und Gewalt aufzustacheln; angemessene Bestrafung, Gefängnisstrafe nur als letztes Mittel; Einschränkungen dürfen nur das Ziel haben, Individuen zu schützen; sie haben nicht die Aufgabe, deren Denk- oder Glaubenssysteme vor Diskussionen, genauer Prüfung oder – auch unvernünftiger – Kritik zu bewahren“ (Callamard 2007).
Читать дальше