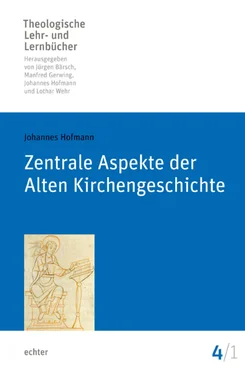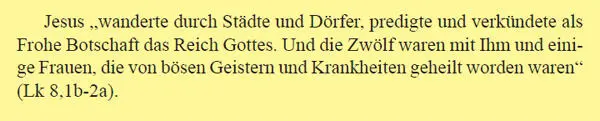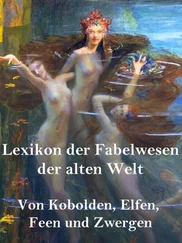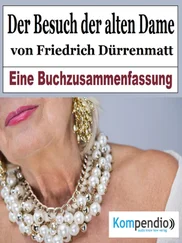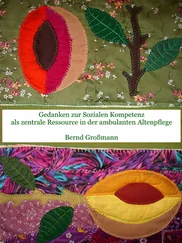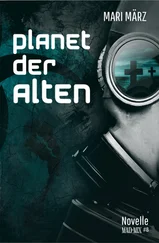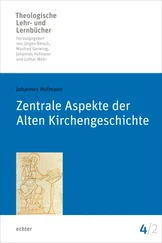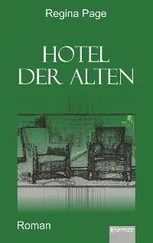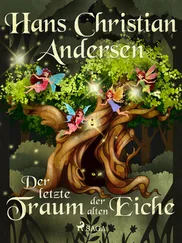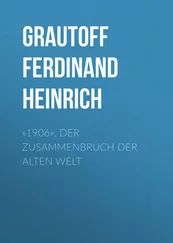| 5.3.4 |
Das Zusammenspiel der Hauptkirchen Antiochien, Rom und Alexandrien im Fall des Paul von Samosata im Jahr 268 |
| 5.3.5 |
Der Einfluss der sogenannten Konstantinischen Wende und der beiden ersten ökumenischen Konzilien auf die Stellung der alten Hauptkirchen im Römerreich und auf den Aufstieg Konstantinopels |
| 5.3.6 |
Das Eintreten des Julius von Rom († 352) für gesamtkirchliche Mitverantwortung und gegen regionale Autonomie |
| 5.3.7 |
Die westliche Anerkennung Roms als Revisionsinstanz auf der 343 einberufenen Synode von Sardica |
| 5.3.8 |
Rom – seit dem Abschluss der arianischen Wirren (um 370) Zufluchtsort der östlichen Kirchen in Notsituationen |
| 5.4 |
Stufe 4: Die Ausbildung des römischen Primats und der Reichspatriarchate vom Ende des 4. Jahrhunderts bis zum Konzil von Chalzedon (451) |
| 5.4.1 |
Die Weiterentwicklung der römischen Primatsidee im Westen seit dem Ende des 4. Jahrhunderts |
| 5.4.2 |
Der geistig-ideologische Hintergrund: Die Roma christiana beerbt die Roma aeterna |
| 5.4.3 |
Der Autoritätsanspruch der ersten drei ökumenischen Konzilien (325-431) und Roms Selbstverständnis auf denselben |
| 5.4.4 |
Das Mit- und Gegeneinander der römischen Kirche und der Reichspatriarchate auf dem 451 abgehaltenen ökumenischen Konzil von Chalzedon |
| 5.4.5 |
Rückblick und Ausblick |
| 6. |
Die ersten vier ökumenischen Konzilien |
| 6.1 |
Das 325 abgehaltene ökumenische Konzil von Nizäa |
| 6.1.1 |
Die Vorgeschichte des Konzils von Nizäa |
| 6.1.2 |
Das Konzil von Nizäa |
| 6.1.3 |
Der Glaube von Nizäa im Widerstreit |
| 6.1.4 |
Die Lösung der nizänischen Frage durch die Kappadokier |
| 6.2 |
Das 381 abgehaltene ökumenische Konzil von Konstantinopel |
| 6.2.1 |
Die Vorgeschichte des zweiten ökumenischen Konzils |
| 6.2.2 |
Das Konzil von Konstantinopel |
| 6.2.3 |
Die Rezeption des Konzils von Konstantinopel |
| 6.3 |
Das 431 abgehalten ökumenische Konzil von Ephesus |
| 6.3.1 |
Die Vorgeschichte des Konzils von Ephesus: zwei unterschiedliche Christologien |
| 6.3.2 |
Das Konzil von Ephesus |
| 6.3.3 |
Die Rezeption und Nichtrezeption des Konzils von Ephesus oder die erste bleibende Kirchenspaltung |
| 6.3.3.1 |
Die Ausbildung der Apostolischen Kirche des Ostens |
| 6.4 |
Das 451 abgehaltene ökumenische Konzil von Chalzedon |
| 6.4.1 |
Die Vorgeschichte des Konzils von Chalzedon |
| 6.4.2 |
Das Konzil von Chalzedon |
| 6.4.3 |
Die Rezeption und Ablehnung des Konzils von Chalzedon oder die zweite bleibende Kirchenspaltung |
| 6.4.3.1 |
Die Ablehnung in der koptischen, nubischen und äthiopischen Kirche |
| 6.4.3.2 |
Die Ablehnung in der armenischen Kirche |
| 6.4.3.3 |
Die Ablehnung in der westsyrischen oder jakobitischen Kirche |
| 6.4.3.4 |
Die Rezeption des Konzils von Chalzedon in der Reichskirche |
Liste der frühen Bischöfe von Rom bzw. der Päpste
Liste bedeutender Kirchenväter und altchristlicher Autoren in chronologischer Reihenfolge
Liste der römischen Kaiser
Abbildungsnachweis
Mit diesem Werk soll Studierenden, Theologen und einem an der Theologie interessierten Kreis ein als gedrucktes Buch, aber auch als eBook publiziertes Lehr- und Lernbuch der Alten Kirchengeschichte zur Verfügung stehen, das auf dem neuesten Forschungsstand jene Themen behandelt, die sich im Lehrbetrieb bayerischer Universitäten als zentral erwiesen haben, weil sie das Leben und die Theologie der Kirche bis auf den heutigen Tag prägen.
Demnach geht es hier um die frühe Ausbreitung der Kirche ( Kapitel 1), ihre ortskirchliche Organisation (Kapitel 2) und ihre einheitsstiftenden Prinzipien und Institutionen (Kapitel 3), um die frühe Begegnung zwischen Kirche und römischem Staat (Kapitel 4), die großräumige Organisation der Alten Kirche (Kapitel 5) und den auf den ersten vier ökumenischen Konzilien entfalteten Glauben der Kirche (Kapitel 6). Der künftige zweite Band gilt dem altkirchlichen Gottesdienst (Kapitel 7) und dem Leben und Werk der überragenden abend- und morgenländischen Väter Augustinus von Hippo Regius (Kapitel 8) und Johannes von Damaskus (Kapitel 9).
Zwischentitel untergliedern die einzelnen Kapitel detailliert, um so rasch und übersichtlich einen Überblick über den Inhalt des Bandes zu vermitteln. Zur Förderung der Einprägsamkeit werden neben wichtigen Begriffen, Namenund Ortenauch zentrale Aussagen des Textes fett markiert. Ebenso veranschaulichen durch farbige Hinterlegung hervorgehobene Quellentexte, aber auch Karten, Graphiken, Bilder und Tabellen den behandelten Stoff. Papst-, Kaiser-, Kirchenväter- und Autorenlisten erleichtern die chronologische Orientierung. Ein Register erübrigt sich, da die Suchfunktion der eBook- Version entsprechende Recherchen ermöglicht.
Unter Verzicht auf einen aufwendigen Anmerkungsapparat wird die neuere und neueste Standardliteratur – je nach Länge und Dichte der Ausführungen – am Ende des jeweiligen Kapitelabschnitts aufgelistet und ihr Inhalt bei Bedarf nach den jeweiligen Seitenangaben in Klammern erschlossen, sodass dort Hinweise zum vertieften Studium zu finden sind. Die wenigen Fußnoten verweisen nur auf wörtliche Zitate, auf unverzichtbare, in der Standardliteratur nicht erwähnte Einzelergebnisse der neueren Forschung sowie auf andere Kapitelabschnitte des vorliegenden Buchs, die den entsprechenden Sachverhalt vertiefter behandeln und im eBook durch Hyperlinks erreichbar sind.
Für die Erstellung des Manuskripts bin ich Frau Sonja Eisenschmid und Frau Ursula Niefnecker zu großem Dank verpflichtet. Ebenso danke ich Herrn Cand. theol. Anselm Blumberg herzlich für die arbeitsaufwendige Bearbeitung der Quellentexte, Karten, Graphiken, Bilder und Tabellen. Schließlich gilt mein herzlicher Dank auch Herrn Stud. theol. Martin Schwerdt für das Lesen der Korrekturen.
Theißing, den 22. Oktober 2011 Johannes Hofmann
Technische Hinweise zur Nutzung der eBook-Version
Im eBook ist vom Inhaltsverzeichnis aus der Text der einzelnen Kapitel und Unterkapitel jeweils durch einen Klick auf die linke Maustaste erreichbar, während man durch Gedrückthalten der Alt-Taste und Drücken der linken Pfeiltaste wieder zum Inhaltsverzeichnis zurückkehren kann. Entsprechendes gilt auch für Hyperlinks, mit deren Hilfe nicht nur jeweils vertiefende Abschnitte des Buchs, sondern auch Abbildungen und vollständige Titel der abgekürzten Literatur zu erreichen sind. Die im Längsformat publizierten Karten lassen sich schließlich unter „Anzeige“ → „Ansicht drehen“ im Uhrzeigersinn ins Querformat drehen.
1. Die Anfänge der Kirche
1.1 Die Ausgangssituation
Vor der Beschäftigung mit den Anfängen der Kirche ist zunächst festzuhalten, dass die Kirche ihren letzten Grund in Jesus Christus hat, in jenem historisch fassbaren Jesus von Nazaret, dessen Wirken der Evangelist Lukas gelungen resümiert:
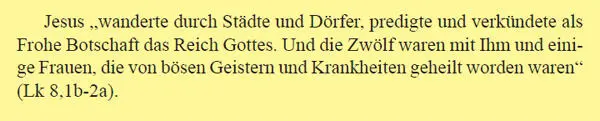
Jesu Wirken ist also von der Verkündigung der Frohen Botschaft vom nahen Gottesreich geprägt, von seiner Realisierung durch die Heilung kranker und von Dämonen besessener Menschen und von der Sammlung einer Schar von Frauen und Männern um sich.
Читать дальше