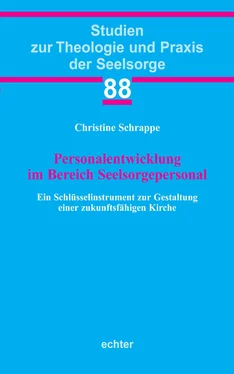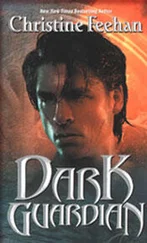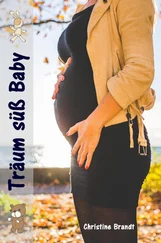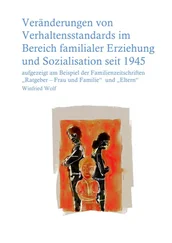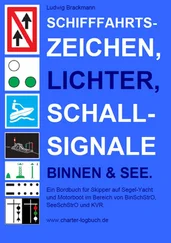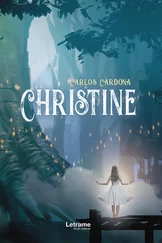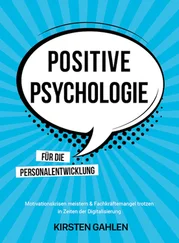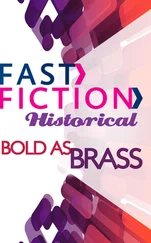3.1.4 Ökonomisierung (ab ca. 1980)
Nach der Phase der Humanisierung der Personalarbeit trat wieder der Aspekt der Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund. Hintergrund waren starke Markt- und Kundenorientierung, Globalisierung und Entwicklung neuer Technologien. Leitbild war der Unternehmer, der sich für das Unternehmen und dessen Erfolg einsetzt. 97Das Ziel hieß Anpassung von Organisation und Personal an veränderte Rahmenbedingungen. Die Interessen des Personals sollten den Unternehmensbelangen untergeordnet und den betrieblichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die Strategie war sowohl Generalisierung wie Zentralisierung, es ging um Entbürokratisierung und um die Rationalisierung von Personalfunktionen.
Durch gestiegenen Konkurrenzdruck im globalen Wettbewerb traten nun Aspekte wie Flexibilisierung der Arbeit, Rationalisierung des Entwicklungspotenzials bis hin zur Orientierung an Freisetzungspolitik in den Vordergrund. Ökonomische Überlegungen bekamen Vorrang. Nun wurde genau geprüft, ob sich innovative Lernformen wie kollegiale Beratung, Lerninseln und Qualitätszirkel auch wirtschaftlich lohnten, viele im Zuge der „Humanisierung“ entwickelten Instrumente des Lernens am Arbeitsplatz und Arbeitsstrukturen wie Teamarbeit wurden wieder zurückgefahren. Zertifizierungsprozesse in Bildungseinrichtungen, Erfolgskontrolle und Erfolgsdokumentation von Schulungsmaßnahmen waren neue Stichworte. Rentabilitätseinschätzungen sollten Art und Umfang entstandener Kosten mit Art und Umfang des gelernten Wissens und dem Ausmaß der sichtbaren Verhaltensänderung vergleichen. In den 80er Jahren setzte sich dabei die Einsicht durch, „dass eine bloße Input-Output-Analyse des Bildungserfolges bei weitem nicht ausreicht, um die Effizienz von Weiterbildungsaktivitäten zu erfassen oder sie gar systematisch zu beeinflussen. Man war darum bemüht, weniger den Erfolgskontroll- als vielmehr den Erfolgssteuerungsaspekt in der Weiterbildungspraxis stärker zu betonen – ein Anliegen, welches auch den Bildungscontrolling-Ansätzen der 90er Jahre zugrundeliegt.“ 98Rolf Arnold benennt vier Qualitätsdimensionen im Bereich betrieblicher Fort- und Weiterbildung:
Der Zufriedenheitserfolg, der dann gegeben ist,
• wenn die Teilnehmer ihrer Zufriedenheit über Verlauf und Ergebnis des Lernprozesses Ausdruck verleihen,
• der Lernerfolg, der über die inhaltliche Qualität des Lernprozesses Auskunft gibt,
• der betriebswirtschaftliche Erfolg, der sich aus einem Kostennutzenvergleich ergibt,
• der Transfererfolg, der dann gegeben ist, wenn mit Hilfe des Gelernten betriebliche Abläufe verbessert werden können. 99
Eine Gefahr wird in Ökonomisierungsbestrebungen deutlich: Personalentwicklungsmaßnahmen wie z.B. das Angebot zu kollegialer Beratung am Arbeitsplatz oder Supervision werden als Privatinteressen behandelt, institutionelle Angebote des Arbeitgebers wie Freistellung in der Arbeitszeit und Bezuschussungen werden eingefroren oder Etats im Bereich der Personalentwicklung zurückgefahren. Bis in die Gegenwart sehen sich die Personalführungs- und Personalentwicklungsabteilungen in deutschen Diözesen nicht selten in Konfrontation mit den Finanzkammern, treffen unterschiedliche Auffassungen von Personalarbeit aufeinander oder stehen Stellen und Aufgaben in der Personalentwicklung zur Disposition, wenn es um Kürzungen geht.
3.1.5 Unternehmerische Orientierung (ab ca. 1990)
Mitarbeiter sind überfordert, wenn sie vor Ort die Reformen oder den Reformstau ertragen, deuten und gestalten und als loyale „Mitunternehmer“ verantworten müssen, ohne selbst Unterstützung zu erfahren durch Schaffung adäquater Arbeitsstrukturen und Bereitstellung entwicklungsfördernder Rahmenbedingungen. Unternehmerische Orientierung meint die Gleichwertigkeit von Organisation und Personal als „Mitunternehmer“. Personalentwicklung wird nicht nur als Aufgabe einzelner Abteilungen, sondern als strategische Aufgabe des Gesamtunternehmens gesehen. „Ging es in den 60er Jahren noch darum, dass Arbeitnehmer befähigt wurden, Anweisungen gut und qualifiziert auszuführen, geht es im Produktions- wie im Dienstleistungssektor immer mehr darum, den gesamten Arbeitsprozess in seinen Teilen zu verstehen, das technische Können mit berufstheoretischen Fähigkeiten zu verbinden und in der Lage zu sein, Abläufe verantwortlich und im Team zu gestalten.“ 100
Arnold sieht in der 1987 von der Öffentlichkeit mitverfolgten curricularen Neuordnung der Ausbildungsberufe im Metall- und Elektrobereich eine Signalwirkung für die Neuausrichtung personalentwicklerischen Handelns: „Was dabei herauskam, war eine didaktische Innovation. Ergebnis waren nämlich Ausbildungsordnungen, die ausdrücklich der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen einen hohen Stellenwert einräumen. Dadurch sollten die Auszubildenden in den neu geordneten Metall- und Elektroberufen in die Lage versetzt werden, in komplexen beruflichen Alltagssituationen Problemlösungen ‚selbstständig planen‘, ‚durchführen‘ und ‚kontrollieren‘ zu können.“ 101Im Bildungsbereich setzte man auf Seminare mit dem Schwerpunkt Problemklärung und Problemlösung, Ziel war die Erhöhung des Problemlösungspotenzials.
Die Entwicklung der Qualifikationsanforderungen auf den Arbeitsmärkten führte dabei zu einer doppelten Erweiterung des betrieblich-beruflichen Lernens: Das Qualifikationslernen weitete sich unter dem Leitziel der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen auch zur Persönlichkeitsbildung. Zudem richtete sich betriebliches Lernen nicht mehr nur auf das Individuum, sondern auch auf die Förderung der Anpassungs- und Überlebensfähigkeit der ganzen Organisation. Innerhalb der pastoralen Ausbildung aller kirchlichen Dienste bedeutete diese „unternehmerische“ Orientierung, dass Themen wie personale Kompetenz, kreative Gestaltungskompetenz, Projektarbeit und Teamfähigkeit als „Hilfe zur Selbsthilfe“ in den Mittelpunkt rückten. Förderung der personalen Kompetenz sollte die Qualität des personalen Angebots der Kirche steigern.
Mitarbeitende sind die wichtigste, wertvollste und sensibelste Ressource eines Unternehmens. Dieser Philosophie folgend soll das Personalmanagement nun Mitarbeiter als Mitunternehmer gewinnen, entwickeln und erhalten. Unternehmerisches Mitwissen, Mitdenken und Mitverantworten ist in allen Unternehmensentscheidungen angestrebt. Mitarbeiter sollen mitwirken bei Unternehmensphilosophie, -politik und -strategie. Auf Evaluation der ökonomischen und sozialen Folgen von Unternehmensentscheidungen wird Wert gelegt. Man betrachtet Personal nun als „Humankapital“ und „Human Ressource“, das Personalmanagement fungiert als „Wertschöpfungs-Center“. Personalentwicklung wird zur nicht delegierbaren Managementaufgabe von hoher Priorität, zur Hilfe zur Selbsthilfe bei der Lösung technischer, sozialer oder organisatorischer Probleme. Statt sich nur an Zielen wie unmittelbarer Positions- und Laufbahnentwicklung auszurichten, hat sich der Begriff der Personalentwicklung erweitert hin zum Verständnis einer systematischen unternehmerischen Aktivität. „Personalentwicklung ist nicht der ‚nachhinkende Erfüllungsgehilfe‘ für organisatorische Veränderungen, sondern Motor für Innovationen im Unternehmen.“ 102Parallel dazu hat sich auch das Verständnis von Organisationen gewandelt: von der Organisationsentwicklung hin zu lernenden Organisation. Aussagekräftig sind nun weniger Organigramme und Prozessstrukturen als das Verhalten der in diesen Organisationen tätigen Menschen. Organisationen werden als veränderbare soziale Gebilde betrachtet; interessant sind nicht so sehr die Technologien, sondern das Veränderungspotenzial, die Lern- und Entwicklungspotenziale des Personals.
In diesen Punkten hat in der Kirche, insbesondere in kirchlichen Sozialeinrichtungen, die den engen Zusammenhang von Wirtschaftlichkeit und „Humankapital“ spüren, ein Umdenken stattgefunden. Auf die unternehmerische Grundhaltung aller Mitarbeiter wird aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen (Verlust des Sinn-Monopols) zunehmend Wert gelegt. Die Mitwirkung vieler Betroffener an unternehmerischen Entscheidungen – wie z.B. Umgestaltung von Arbeitsbereichen, höhere „Kundenfreundlichkeit“ und Denken in Prozessen (die dem Menschen dienen, z.B. dem Patienten in einem Krankenhaus) statt Denken in Abteilungen – wird als unverzichtbarer Baustein verantworteter Unternehmensführung betrachtet. Unternehmerische Orientierung bedeutet im Sinne Karl Berkels Wille zur Führung als „zielgerichtete Einflussnahme“ 103und proaktive Gestaltung der Zukunft mit hoher Eigeninitiative.
Читать дальше