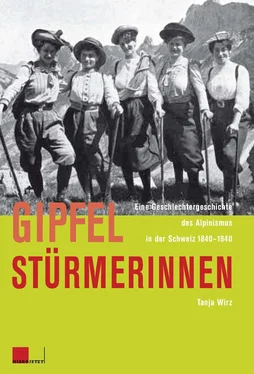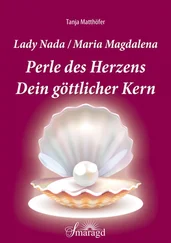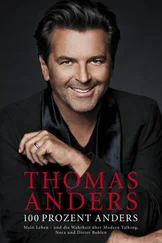«Lässt sich konstatieren, dass das Jodeln auch reiner, unbeabsichtigter Reflexlaut der Stimmung ist, d. h. gibt es Stimmungen, in denen der Bergbewohner ohne Rücksicht auf das Gehörtwerden, ja auf das Sichselbsthören, den äussern Ausgleich derselben im Jodeln in ähnlicher Weise sucht, wie man ihn im Schmerz im Schreien und Seufzen sucht? […] Was sind das für Stimmungen? Etwa u. a. die der geschlechtlichen Erregung? […] Jodeln auch Frauen, von welchem Alter an, und unterscheidet sich dies vom Jodeln der Männer?» 157
Diese Jodelforschung sollte die Grundlage seiner Dissertation «Psychologischethnographische Studien über die Anfänge der Musik» bilden, worin er Darwins These widerlegen wollte, die menschliche Sprache habe sich aus der Musik entwickelt. Simmel war demgegenüber der Ansicht, am Anfang sei die Sprache, die Kommunikation gestanden. 158Auf seine Anfrage erhielt der junge Forscher tatsächlich einige Antworten, doch leider, so schrieb er, «standen dieselben gegenseitig in so vielen Widersprüchen, dass angenommen werden muss, das Jodeln sei in den verschiedenen Alpengegenden charakteristisch verschieden.» 159Immerhin gelangte Simmel zum Schluss, Jodeln sei eine Methode, sich im Gebirge durch kunstvolles Schreien zu verständigen, und habe mit dem «Geschlechtstrieb» nichts zu tun. 1601881 reichte Simmel die Arbeit ein, doch seine Prüfer bemängelten die Methodik und Themenwahl und lehnten sie ab. Seinen Studienabschluss machte Simmel schliesslich mit einer philosophischen Studie zum Wesen der Materie nach Kant. 161Über die Alpen verfasste er später diverse Essays. 162
ARKADIEN IN DEN ALPEN: ALBRECHT VON HALLERS UND JEAN-JACQUES ROUSSEAUS UTOPIEN
Nicht die Landschaft, sondern ihre – allerdings stark idealisierten – Bewohner stehen im Zentrum eines weiteren, für den Alpinismus wichtigen Reisestils: Die Vorstellung, im Hochgebirge ein «Goldenes Zeitalter» finden zu können. Grossen Einfluss auf diesen Reisestil hatte das 1729 erschienene Gedicht «Die Alpen» des Berner Arztes und Naturforschers Albrecht von Haller (1708–1777), in dem die Bergbewohner als unschuldige, arkadische Hirten auftreten. Der Berner verfasste die antikisierende Ode nach einer botanische Alpenreise, die er 1728 unternommen hatte. Es entsetzte ihn, dass die Bevölkerung des Berner Oberlandes damals so verarmt war, dass sie abzuwandern begann und sein Gedicht war ein Angriff auf die korrupte Moral der Gesellschaft. 163Gleichzeitig enthält es viele Ideen, wie die Bevölkerung der Berggebiete aufgrund der natürlichen Ressourcen ein Auskommen finden könnte.
Anhand einer Reihe von Alltagsszenen argumentierte Haller, die in den Bergen lebenden «Hirten» seien den mächtigen, reichen Menschen in den Zentren moralisch überlegen. Er knüpfte dabei an die antike Vorstellung eines goldenen Zeitalters an und meinte, dieses glückliche Leben gebe es immer noch, und zwar in den Alpen. Wohl sei das Klima dort überaus hart, fördere aber die Entstehung besonders wertvoller Sitten. 164Die Bergbewohner seien zwar arm, hinterfragten ihre Stellung aber nicht: «Dem, den sein Stand vergnügt, dient Armut selbst zum Glücke», schrieb er und fügte hinzu: «Lust und Hunger legt auch Eicheln Würze zu.» 165Hallers Botschaft: Das mässige Leben auf dem Lande sei zu Unrecht verachtet, Reichtum in Wirklichkeit eine «güldne Kette», die den «erdrückt, der sie trägt», und das Leben in der Stadt voller Rauch, Bosheit und Verrat. 166Die Alpenbewohner hingegen würden – ganz aufklärerische Idealmenschen – in Eintracht und Freiheit zusammenleben. 167
«Hier herrscht die Vernunft, von der Natur geleitet», fuhr Haller fort und wies darauf hin, dass es sich bei den Bergbewohnern um jene edlen Hirten handelte, welche seine gebildete Leserschaft aus antiken Schriften kannte: «Was Epictet getan, und Seneca geschrieben, sieht man hier ungelehrt und ungezwungen üben.» 168Als besondere Tugenden der Bergler erwähnte er ihre Keuschheit und Treue und meinte, sie seien zwar etwas ungehobelt, aber sehr fröhlich – ein Stereotyp, das in heutigen Reiseberichten immer noch anzutreffen ist, die im bereisten Land jeweils ein etwas unbedarftes, aber dafür umso lustigeres Völkchen ausgemacht haben wollen. 169Haller meinte ausserdem, harte Arbeit und karge Ernährung förderten die Gesundheit, welche noch dazu vererbbar sei: «In ihren Adern fliesst ein unverfälscht Geblüte, darin kein erblich Gift von siechen Vätern schleicht, das Kummer nicht vergällt, kein fremder Wein befeuret, kein geiles Eiter fäult, kein welscher Koch versäuret.» 170Kurz: keine fremden Köche, keine Erbkrankheiten – ein früher Vorgeschmack auf spätere Fantasien eines «gesunden Volkskörpers».
Die wichtigste Eigenschaft der Bergler war für Haller aber, dass sie trotz ihres Daseins weitab jeglicher städtischer Gelehrsamkeit durch ihr naturnahes Leben zu wahren Weisen geworden seien: So lehre einer die anderen Wetterkunde, die er ganz aus «eigener Erfahrung» gelernt habe, und ein «Greis» spreche im Kreise der Familie von vergangenen Schlachten. In patriotischer Begeisterung schrieb Haller: «Er ist ein Beispiel noch von unsern Helden-Ahnen.» 171Ein anderer weiser Alter sei «ein lebendes Gesetz, des Volkes Richtschnur» und lehre, «wie die feige Welt ins Joch den Nacken strecket, wie eitler Fürsten Pracht das Mark der Länder frisst, wie Tell mit kühnem Mut das harte Joch zertreten, das Joch, das heute noch Europens Hälfte trägt». 172Und schliesslich gibt es einen «muntern Alten, der die Natur erforscht, und ihre Schönheit kennt; der Kräuter Wunder-Kraft und ändernde Gestalten hat längst sein Witz durchsucht, und jedes Moos benennt», er weiss, wo Gold zu finden ist und wo es Schwefelquellen gibt: «Er kennt sein Vaterland», das sich dadurch auszeichne, dass dort auf kleinem Raum besonders viele, andernorts seltene Naturerscheinungen vereint seien. 173Frauen kommen in dieser alpinen Idealgesellschaft praktisch keine vor.
Obwohl Haller von der wirtschaftlichen Not im Berner Oberland schockiert war, stellte er also das Leben der Bergbewohner als erstrebenswertes Gegenbild zur städtischen Gesellschaft dar, die er für korrupt, servil und falsch hielt. Seine Älpler waren edle Wilde, die trotz Armut frei und gleichberechtigt waren und über nützliche Naturerzeugnisse und Bodenschätze verfügten. Das Gedicht hatte durchschlagenden Erfolg, was darauf schliessen lässt, dass das Bedürfnis nach einem Paradies der Vorzeigedemokraten, einer Projektionsfläche für neue politische Ideen, damals gross war.
DIE ALPEN ALS GEGENWELT
Haller war nicht der Einzige, der in den Alpen politische Leitbilder suchte: Viele Aufklärer glaubten, in den schweizerischen Bergen den Geburtsort der Demokratie gefunden zu haben. Ein anderer Autor, der viel zur Verbreitung des Topos vom edlen Wilden aus den Alpen beigetragen hat, ist der Genfer Philosoph und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Während Haller nicht müde wurde, auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Berggebiet hinzuweisen, hielt Rousseau wenig vom Fortschritt; er hätte die vermeintlichen Naturkinder der Alpen lieber weiterhin ausserhalb des Einflusses der modernen Welt gesehen.
In seinem 1761 erschienenen Briefroman «Julie ou la Nouvelle Héloïse», der die unmögliche Liebe zwischen dem bürgerlichen Intellektuellen Saint-Preux und der adligen Julie d’Étanges zum Thema hat, pries auch er die Berge als heile Gegenwelt zum moralzersetzenden Stadtleben. Über die Bewohner des Oberwallis schrieb er, sie seien einfach, ruhig, glücklich und ohne jegliches Geschäftsinteresse. Überhaupt sei Geld dort rar, was aber für die Moral nur gut sei. Rousseau mutmasste, die Bergler hätten die Abschottung von der modernen Geldwirtschaft in ihrer grossen Weisheit selbst gewählt, indem sie verboten, nach dem angeblich vorhandenen Gold zu schürfen. 174Immer wieder wird der Protagonist des Romans, der in den Bergen reisende Hauslehrer Saint-Preux, von den Einheimischen zum Essen, Trinken und Übernachten eingeladen, ohne dass dafür eine Bezahlung erwartet oder angenommen wurde. 175Dieser Topos der grosszügigen und nicht auf Gewinn bedachten Einheimischen machte Rousseaus Leserschaft offenbar grossen Eindruck: Spätere Touristen waren manchmal recht kläglich enttäuscht, wenn sie nicht einfach überall umsonst fordern und nehmen konnten, was ihnen gerade beliebte; empörte Bemerkungen über die Geschäftstüchtigkeit und Geldgier der einheimischen Gastgeber gehören zum stehenden Repertoire des alpinistischen Diskurses.
Читать дальше