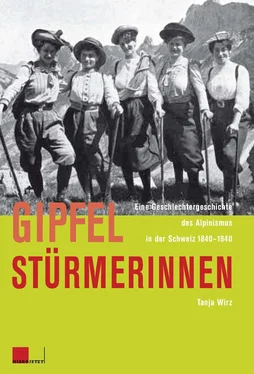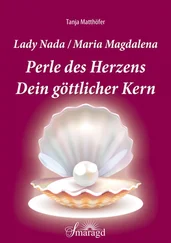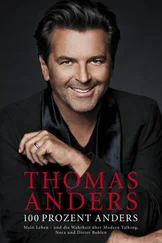1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Unterwegs mussten die beiden Brüder einen Hirten nach dem Weg fragen. Dieser versuchte, sie abzuhalten: In seiner Jugend habe er den Berg ebenfalls bestiegen, doch habe es ihm nur Reue, Mühsal und einen zerschundenen Leib und Mantel eingebracht. Seither habe es niemand mehr gewagt, meinte er. Diese Warnung, konstatierte Petrarca, habe sein Verlangen jedoch bloss gesteigert. 67Gelegentlich wird diese Stelle daraufhin interpretiert, es zeige sich hier die Angst der Einheimischen vor den Bergen und der ihnen fremden Natur, doch auch dies halte ich für eine Interpretation aufgrund späterer Topoi aus dem alpinistischen Diskurs. 68Mir scheint eher, Petrarca versuchte zu zeigen, dass ein ungebildeter Hirte den Wert einer spirituellen Reise nicht zu schätzen wusste, denn von Angst ist hier nirgendwo die Rede. Petrarcas Hirte ist nicht primär gegenüber der Landschaft blind, sondern gegenüber dem Wert der Seelenerforschung. Ausserdem dürfte Petrarca daran gelegen gewesen sein, das Berggebiet auf diese Weise als menschenleer und aussergewöhnlich darzustellen. Als sie schliesslich den Gipfel des Berges erreichten, berichtete Petrarca, habe ihn der «ungewohnte Hauch der Luft» und die «ganz freie Rundsicht» geradezu betäubt. Es sei ihm gewesen, als stehe er auf dem Athos oder dem Olymp, dem Berg der Götter. Der Blick Richtung Italien liess vaterländische Gefühle aufkommen, doch die empfand Petrarca als zu zärtlich und unmännlich – Skrupel, die spätere Bergsteiger nicht mehr kannten, sollte Vaterlandsliebe doch zur geradezu paradigmatisch «männlichen» Emotion werden. 69
Nicht der Blick über die Landschaft war das eigentliche Ziel Petrarcas, sondern er wollte herausfinden, wie sein Leben weitergehen sollte. Die Antwort darauf suchte er nicht in der Naturbetrachtung, sondern er wandte sich an die Autorität der Heiligen, die er in Form eines Buches mitgebracht hatte: «Während ich dies eins ums andere bestaunte und bald an Irdischem Geschmack fand, bald nach dem Beispiel des Körpers die Seele zu Höherem erhob, kam ich auf den Gedanken, in das Buch der Bekenntnisse des Augustinus hineinzuschauen, […] um zu lesen, was mir gerade vor die Augen treten würde.» 70Er schlug also das Buch, in dessen Form er Augustinus als spirituellen Lehrer dabei hatte, willkürlich irgendwo auf und las: «‹Und es gehen die Menschen hin, zu bewundern die Höhen der Berge und die gewaltigen Fluten des Meeres und das Fliessen der breitesten Ströme und des Ozeans Umlauf und die Kreisbahnen der Gestirne – und verlassen dabei sich selbst.›» 71Dies zu lesen habe ihn nachgerade «betäubt», und er fuhr fort:
«[…] ich schloss das Buch, zornig auf mich selber, dass ich jetzt noch Irdisches bewunderte, ich, der ich schon längst selbst von den Philosophen der Heiden hätte lernen müssen, dass nichts bewundernswert ist ausser der Seele: Im Vergleich zu ihrer Grösse ist nichts gross. Dann aber wandte ich, zufrieden, vom Berg genug gesehen zu haben, die inneren Augen auf mich selbst, und von jener Stunde an konnte keiner mich reden hören, bis wir ganz unten angelangt waren; jenes Wort hatte mir genügend stumme Beschäftigung gebracht.» 72
Dieselbe Erfahrung, so fügte Petrarca an, habe übrigens auch Augustinus gemacht: Der habe zufällig eine Stelle in den Apostelbriefen aufgeschlagen, die besagte, man solle den eigenen Körper vernachlässigen, um nicht von seinen Lüsten geknechtet zu werden. 73Der Berg schien Petrarca plötzlich klein und eine blosse Metapher für die wirklich wichtigen Dinge im Leben:
«Wenn es einen nicht verdross, so viel Schweiss und Strapazen auf sich zu nehmen, damit nur der Leib dem Himmel etwas näher wäre, welches Kreuz, welcher Kerker, welche Folter dürfte dann die Seele erschrecken, die sich Gott nähert und dabei den aufgeblasenen Gipfel der Überheblichkeit und die Geschicke der Sterblichkeit mit Füssen tritt? Ferner: Wie vielen wird es überhaupt gelingen, dass sie von diesem Pfad, sei es aus Furcht vor harten Bewährungen, sei es aus Begierde nach behaglichem Leben, nicht abschweifen? Oh, überglücklich ist ein solcher Mensch – wenn es je einen solchen gibt!» 74
Für sein philosophisches Experiment hatte Petrarca mit Augustinus also ein weiteres berühmtes Vorbild, das ebenfalls durch religiöse Ermahnung zur Einsicht gelangt war, im Vergleich zum ewigen Seelenheil seien irdische Leidenschaften unwichtig. Möglicherweise suchte Petrarca die sinnliche Erfahrung einer Bergreise ja gerade deswegen, weil er sich davon dank der Lektüre von Augustinus von vornherein die Erkenntnis versprach, dass die Religion vorzuziehen sei – eine Erkenntnis, die ihm als Kleriker vermutlich eher Seelenfrieden versprach als die Wahl materieller, irdischer Genüsse.
Zu einer ähnlichen Interpretation gelangen die deutschen Kulturhistoriker Ruth und Dieter Groh, die der Ansicht sind, weder die Herausforderung der Bergbesteigung noch das Erlebnis der Landschaft seien in Petrarcas Text wichtig: Es handle sich um eine Bekehrungsgeschichte, in der es nicht um Ästhetik, sondern um seelische Nöte und Orientierungslosigkeit gehe. Für diese These spricht, dass Petrarca in seinem restlichen Werk nirgends über die äussere Natur geschrieben hat. 75Da ich ausser dem Bericht über die Wanderung auf den Mont Ventoux keine weiteren Schriften Petrarcas untersucht habe, soll nicht versucht werden, abschliessend zu beurteilen, wie Petrarca es mit der Natur hielt und was er «eigentlich» gewollt hatte. Vielmehr scheint mir interessant, dass viel später moderne Bergbegeisterte im Renaissancedichter einen alpinistischen Vorfahren zu erkennen glaubten und in seinen Bericht all das hineinlasen, was ihnen wichtig war: ästhetischer Landschaftsgenuss als moderne Kulturtechnik, Entdeckung und Eroberung unbekannten Territoriums, die Überwindung von Aberglauben, das Ausloten der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit. Petrarcas Text wurde somit im alpinistischen Diskurs zum Spiegel, in dem moderne Bergsteiger zu sehen versuchten, was sie selbst gerne gewesen wären.
Die Deutung, Petrarca sei einer der Ersten gewesen oder gar der Allererste überhaupt, der die Landschaft und Natur als solche wahrgenommen habe, wurde bald zum Allgemeinplatz und führte dazu, dass manche vom Originaltext des Berichts geradezu enttäuscht waren: Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt (1769–1859) etwa monierte, Petrarca lasse jegliches «Naturgefühl» vermissen. Doch das Fehlen expliziter Naturschwärmerei hielt Petrarcas Leser nicht ab, dennoch solche in seinen Texten zu vermuten. So entgegnete der schweizerische Kunsthistoriker Jacob Burckhardt (1818–1897), Petrarca habe wohl Naturgefühl gehabt, doch sei er davon eben derart überwältigt gewesen, dass ihm die Worte gefehlt hätten. 76Petrarca musste einfach der Erste sein, der Landschaft wahrnahm, so sehr hatte sich die These zum Dogma gefestigt, und wenn es dazu eines argumentativen Salto mortale bedurfte.
GOTTES GNADE ODER EIGENE LEISTUNG?
Im alpinistischen Diskurs spielte Petrarcas Bericht wohl auch deshalb eine so grosse Rolle, weil der Reisestil der Pilgerreise unter Bergsteigern weit verbreitet ist. In fast allen von mir untersuchten Tourenberichten wird irgendwo angetönt, dass es sich beim Hochgebirge um einen sakralen Raum handle, aus dem die Reisenden verändert und verbessert zurückkehrten. Das Benutzen religiöser Metaphern dient dabei auch dazu, das Beschriebene als besonders wichtig erscheinen zu lassen, ohne dies weiter erklären zu müssen. Auch Henriette d’Angeville drückte ihre Erlebnisse in religiösen Topoi aus, allerdings vergleichsweise zurückhaltend. Sie erzählte, unterwegs bei der Betrachtung des Nachthimmels eine überirdische Stimme vernommen zu haben, die ihr Mut zusprach: «Il me sembla seulement qu’une voix descendue du ciel me disait: Fais le bien, et suis ta route avec confiance.» 77Ausserdem bedauerte sie am Ende ihres Berichts, dass sie auf dem Gipfel vor lauter Überwältigung versäumt hatte, Gott für ihren Erfolg zu danken. 78Offenbar meinte sie, es hätte eigentlich dazu gehört, dort oben nicht nur patriotische, sondern auch fromme Gefühle zu hegen. In ihrem Tagebuch hingegen machte sie kaum religiöse Bemerkungen, sondern betonte, es sei zwar für sie gebetet worden, doch der Erfolg ihrer Expedition sei keine blosse Gnade des Himmels: Fromme Gefühle waren Angeville offenbar eher fremd. Umso bezeichnender ist es, dass sie glaubte, im zur Veröffentlichung gedachten Bericht solche einflechten zu müssen, beispielsweise, indem sie das unterwegs gesammelte Herbarium als «Reliquie» bezeichnete, die sie von ihrer «Pilgerfahrt» auf den Montblanc nach Hause brachte. 79
Читать дальше