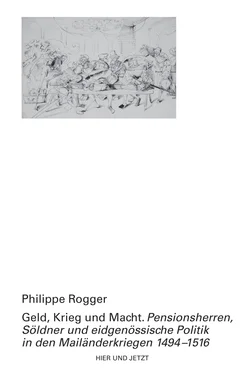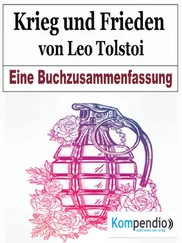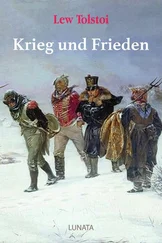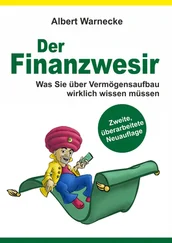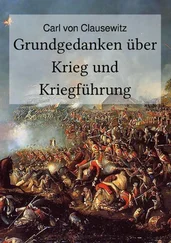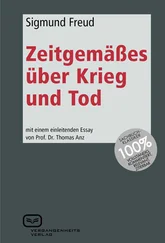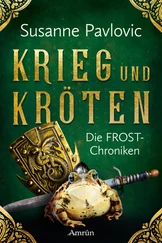Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht
Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld, Krieg und Macht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Unruhen in Solothurn schwelten noch einige Zeit weiter. Dabei hatten möglicherweise auch Stadtbürger, welche die Untertanen laut Klagen des Rats etwa in Aedermannsdorf aufgewiegelt haben sollen, ihre Hand im Spiel. 207In Plombières kam es im Juni (oder Anfang Juli) 1514 zu einem Treffen, an dem unter anderem der Berner Peter Dittlinger, der Luzerner Hans Ratzenhofer, Gerold Löwenstein und ein Kalbermatter aus Basel teilnahmen. 208Über den Inhalt dieser Zusammenkunft ist jedoch fast nichts bekannt, ausser dass man sich «mitt abuertigung der post bottenn zu(o) vnnsrenn vyenndenn gan Dysionn vnnd sundrenn practikenn» befasste. 209Sässeli war an diesem Treffen nicht anwesend. Er kehrte im Juli, nachdem er noch am 1. April mit Thoman Schmid von Olten nach Frankreich gezogen war, 210nach Balsthal zurück. Danach begab er sich, offenbar ohne weiterhin für Frankreich zu agitieren, 211ins Elsass, wo er im September 1514 aufgegriffen wurde. Um die Jahreswende 1515/16 kam er nach einem langwierigen Prozess in Ensisheim frei. 212Peter Dittlinger wurde im Anschluss an die Zusammenkunft in Plombières von der Basler Obrigkeit verhaftet. 213In einem Schreiben Berns an Basel vom 13. Juli nahm die Stadt die Verhaftung mit Befriedigung zur Kenntnis, teilte jedoch besorgt mit, «wie dann ein annschlag vorhanndenn». 214Im Juli und August verbreitete sich das Gerücht, dass 6000 Luzerner, Berner und Solothurner sich in Liestal versammeln wollten, um den ausstehenden Dijoner Sold eigenmächtig beim französischen König einzufordern. 215Ein Zusammenhang dieser Reden mit dem Treffen in Plombières ist sehr wahrscheinlich. Der zweite Dijonerzug kam jedoch nicht zustande. Obwohl es in der Folge auf der Solothurner Landschaft verschiedentlich zu Zusammenkünften der Untertanen kam (Olten, Härkingen), 216beruhigte sich die Lage allmählich. 217Am 7. September erfolgte die Begnadigung von Ulrich Straumann. 218Löwenstein, der für eine Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Eidgenossenschaft und Frankreich lobbyiert hatte, fand an der Tagsatzung kein Gehör. Die eidgenössischen Boten erklärten, «dz der erberkeit in vnser löblichen Eydgnoschaft sölich verräterschen swer handlungen leid syent.» 219In einem Schreiben wandte sich Löwenstein deshalb am 17. Oktober 1514 an Schultheiss Niklaus Conrad und den Rat von Solothurn. Darin warnte er seine Heimatstadt, «das seltzam groß anschläg beschend uff ein eydtgnon». 220Nach weiteren Details bat er die «gnedigen, min frommen herren, so wyt ich do(e)rff zu(o) úwern wyßheit komen, wo(e)lt ich úch eigenlich underrichten.» 221Dann fügte er an: «Mo(e)cht etlicher sprechen: ich tätt dorumb, domit ich heim käm, ist nit, an ich wär von gantzem hertzen gern heim; dann ein gu(o)t eydtgnoß wil ich ersterben unnd in sunderheit ein gu(o)tter Soloturner.» 222Die Tagsatzung lehnte sein Geleitsersuchen jedoch vorerst ab, 223weshalb die Rückkehr nach Solothurn erst zwei Jahre später, im August 1516, gelang. 224
5 Der Lebkuchenkrieg in Zürich
Zürich überstand die Ereignisse im Sommer 1513 relativ unbeschadet. Im Gegensatz zu den anderen drei Städten gelang es der Zürcher Obrigkeit, die militärisch-diplomatischen Verwicklungen in Oberitalien durch ein hohes Mass an innenpolitischer Integrationsfähigkeit aufzufangen. Christian Dietrich verweist hierfür auf die gradlinige Zürcher Aussenpolitik sowie auf eine – im Gegensatz zu den anderen Orten – geglückte Rückkoppelung problematischer Entscheidungen an die Haltung der Untertanen mittels Ämteranfragen. 225
Bereits 1512 ging der städtische Rat gegen Auswüchse im Soldgeschäft vor (Stapfer-Prozess) 226und schritt 1512/13 entschieden gegen die französische Interessenpolitik ein. «Vor ettwas tagen», teilten Bürgermeister und Rat am 21. März 1513 den anderen Orten mit, «ist in vnser stat vilerleÿ red vsgangen, wie die Franzosen sondrigen personen ettlich sunnen kronen ingeantwurt vnd denen befolhen habent, sollich kronen vnder personen vnsers kleinen vnd grossen rates ouch der gemeind vszu(o)teilen vnd da mit zu(o)erlangen, das zwuschent dem franckrichisten kung vnd vnser loblichen Eidgnosschaft ein frid vnd bericht gemacht vnd dadurch vnser Eidgnosschaft knecht in des kungs dienst vffbra(e)cht». 227Der Rat fasste deshalb den Beschluss, «so(e)llicher handlung nach zegond», und verlangte, dass «so(e)llich practicieren, gelt geben vnd ne(a)men abgestelt werde». 228Nach Meinung der Obrigkeit war nämlich «zu(o) besorgen, das es vnser loblichen Eidgnosschafft zu(o) mindrung vnser eren, lobs vnd harkomens traffenlich dienen vnd mercklichen grossen widerwillen, vffru(o)r vnd zweytre(a)cht werd stifften, dem aber wir vnnsersteils gern vor sin vnd halten welten». 229Ihre Tagherren wies die Stadt an, dass sie mit der französischen Gesandtschaft «weder essen, trincken, och kein vererung von Inen nemen noch gar keinerley gmeinsamy mit ihnen haben» sollten. 230Zürich lehnte im März 1513 eine Geleitserteilung für die französische Gesandtschaft ab 231und liess im Juli im Grossmünster ein Verbot der privaten Pensionen beschwören. 232Die von der Obrigkeit eingeleiteten Untersuchungen «vff die vnru(o)w ouch das nachgon des frantzösischen geltz vnd der hoptlutten halb» wurden mit viel Aufwand betrieben und förderten umfangreiches Beweismaterial zu Tage. 233Selbst der Landvogt im Thurgau wurde damit beauftragt, entsprechende Untersuchungen anzustellen. 234Die Anstrengungen Zürichs wurden von den mit Frankreich verfeindeten Mächten, etwa vom mailändischen Gesandten, wohlwollend zur Kenntnis genommen. 235Zu Beginn des Jahres 1513 schienen die anti-französischen Kreise in Zürich die Zügel der Politik fest in der Hand zu halten. 236
Im zeitlichen Umfeld der Schlacht von Novara blieb es ruhig auf der Zürcher Landschaft. Lediglich im Zusammenhang mit dem Zug der Eidgenossen nach Dijon meldeten sich die Untertanen mit dem sogenannten «Anbringen» zu Wort. 237Dieser von einer Delegation vermutlich mündlich vorgebrachte, harmlose Frage- und Klagekatalog umfasste ganz unterschiedliche Themenbereiche, etwa die Berücksichtigung der Landschaft bei der Besetzung von Unterführerposten oder die Modalitäten bei Soldauszahlungen und Kriegsentschädigungen. Zudem forderten die Untertanen ein Pensionenverbot und verlangten, dass das Reislaufen jedem freistehen müsse. Das Dokument schliesst mit der pauschalen Forderung, dass das alte Herkommen der Gemeinden garantiert werden soll. Diese Garantie wurde den Untertanen in einem Antwortschreiben zugesagt, wobei auch die anderen Punkte zur allgemeinen Zufriedenheit geklärt werden konnten. 238Erst die politisch-militärische Konstellation in der Eidgenossenschaft nach der Schlacht von Marignano am 13./14. September 1515 führte zu massiven inneren Spannungen in Zürich. Gegen 10 000 Eidgenossen, nahezu die Hälfte der für diese Kampagne angeworbenen Knechte, hatten insgesamt vor den Toren Mailands ihr Leben gelassen. 239Auch in Zürich war der Blutzoll ungewohnt hoch: Während der Stadtstaat nach der Schlacht von Novara 69 Gefallene zu beklagen gehabt hatte, handelte es sich bei Marignano um rund 800 Tote. 240Die Schuldigen für dieses Gemetzel waren rasch gefunden. «Nachdem nun die Eydgnossen so ubel zu Marian verloren hattend und mencklich umb die synen truwret», so Stumpf, «da ward allermeyst die schuld des verlürsts uff die tütschen Franzoßen gelegt». 241Es gibt in diesem Zusammenhang Anzeichen dafür, dass bei der Eskalation des Konflikts in Zürich auch auswärtige Mächte ihre Hände im Spiel hatten.
Unmittelbar nach der Niederlage in Marignano begannen die Friedensverhandlungen mit Frankreich in Genf. Doch anstatt den eidgenössischen Orten harte Friedensbedingungen zu diktieren, machte der siegreiche König dem unterlegenen Gegner – wohl mit Blick auf die eidgenössischen Söldnermärkte – grosszügige finanzielle und handelspolitische Angebote sowie weitgehende territoriale Zugeständnisse. 242Gleichzeitig verstärkte auch Maximilian I. seine Bemühungen um die Gunst der Eidgenossen, da er beabsichtigte, die Franzosen mit Hilfe eidgenössischer Söldner aus Mailand zu vertreiben. Aus diesem Grund schickte er seinen Rat Doktor Wilhelm von Reichenbach in die Eidgenossenschaft. 243Die gewünschte Allianz mit den Orten blieb jedoch aus. Möglicherweise veranlasste dieser Misserfolg die kaiserliche Diplomatie dazu, ihre Strategie zu ändern. An der Tagsatzung Mitte Dezember wurde der Vorwurf an die Adresse des Kaisers laut, sein Gesandter Reichenbach habe unter den Angehörigen von Zürich «etwas vffwysung gethan, das man vngezwifelt sye, sy sigent deß in sölich vnruw kommen.» 244Auch in Bern soll Reichenbach die Untertanen aufgewiegelt haben. 245Glaubt man dem Chronisten Schwinkhart, hätten dadurch die Friedensverhandlungen mit Frankreich torpediert werden sollen. Reichenbach, so Schwinkhart, «forcht der fryden wo(e)llte ein fürgang na(e)men vnd verschreyb deren von Zürych landtlüten, wie grosse betrugnus jn der Eydtgnoschaft wa(e)re, dardurch der künig jn Lompardy kommen wa(e)re vnd denen Eydtgnossen grossen schaden zu(o)gefüegt h(e)tte.» 246Auf diese Weise habe Reichenbach mit «denen worten vnd ander vil luginen» die Untertanen gegen die Obrigkeit aufgebracht. 247Sehr lebendig berichtet auch Bullinger von der negativen Stimmung gegen die pro-französischen Kreise: «Vnd alle die ÿe frantzo(e)sisch gewesen vnd vom ko(e)nig pensionen gehept, die wurdend gar ha(e)fftig gehassen vnd inen vil schuld dess verlursts ga(e)ben. Insonders schallt ÿederman die houptlüth […] vnd ward geredt, die Eÿdtgnossen werind von iren selbs lüthen verradten». 248Bereits wurden erste Namen angeblicher Verräter laut. Leute wie Caspar Bachli 249aus Zürich oder Albrecht vom Stein 250aus Bern hatten sich daraufhin wegen Kollaborations- und Korruptionsvorwürfen gerichtlich zu rechtfertigen. Die Verbreitung von Gerüchten und Anschuldigungen nahm dabei ein solches Ausmass an, dass sich die Tagsatzung gezwungen sah, unbegründete Verdächtigungen unter Strafe zu stellen. 251
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.