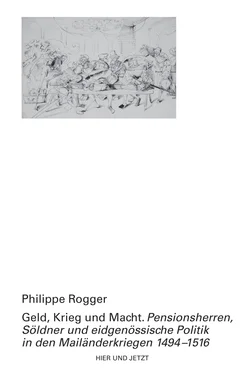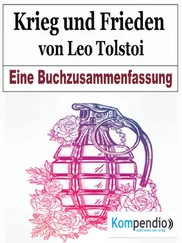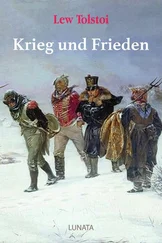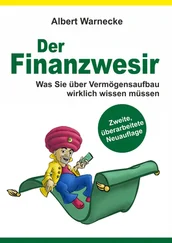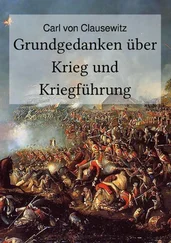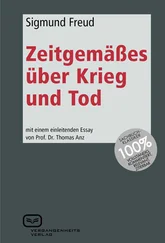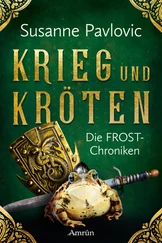Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht
Здесь есть возможность читать онлайн «Philippe Rogger - Geld, Krieg und Macht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Geld, Krieg und Macht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Geld, Krieg und Macht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Geld, Krieg und Macht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Geld, Krieg und Macht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Geld, Krieg und Macht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Für Niklaus Conrad war eine Rückkehr nach Solothurn zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Während er im Ausland ausharrte, 177liess ihn die Obrigkeit am 17. August wissen, «dz min hernn im gern wo(e)ltent helffen. So sind sy nit meister vnd dorumb mag er sich wol enthalten an siner gewarsami, biß man jetz mit der paner wider har heim komet vnnd mit den landtluten wyter mugent reden». 178Seine Rehabilitation erfolgte erst am 6. September an der Zürcher Tagsatzung. 179Im Anschluss daran verlangten Irmi, Gasser, Stölli und Ochsenbein die Herausgabe der Urfehde (20. November). Stölli und Ochsenbein forderten wenige Wochen später ihre Rückkehr in den Rat. Man vertröstete die beiden allerdings auf die Neuwahlen im nächsten Jahr, um «merer nach red vnnd vnru(o)wen» zu vermeiden. 180Niklaus Conrad gelang die Rückkehr in die Politik spätestens am 12. Oktober 1513, als er in der Funktion eines Unterhändlers an den Verhandlungen über die künftige Vogteiverwaltung, die von den Untertanen während der Unruhen beanstandet worden war, teilnahm. 181Stölli und Ochsenbein schafften die Wahl in den Rat am 24. Juni 1514 ohne vernehmbaren Widerspruch der Untertanen. 182Einzig die Tagsatzung hielt die Rückkehr Stöllis, Ochsenbeins und Conrads in die Politik für verfrüht. 183
Angesichts der anhaltenden Spannungen um 1513/14 sind die Bedenken der Tagsatzung nachvollziehbar. So hatte sich der Schultheiss Daniel Babenberg im Zusammenhang mit den Dijoner Friedensverhandlungen wegen der Bestechungsvorwürfe vor der Tagsatzung zu verantworten. 184Es zirkulierte das Gerücht, dass Frankreich gemäss den Bestimmungen des Dijoner Friedensvertrages 50 000 Kronen bezahlt habe, das Geld jedoch in unbekannten Kanälen versickert sei. Diese Reden brachten die Obrigkeiten in Solothurn, Bern und Luzern erneut in Bedrängnis. Weitere Untersuchungen über den Verbleib dieser Summe wurden an der Tagsatzung Ende 1513 und im Februar 1514 angestrengt, nachdem insbesondere auf der Berner Landschaft der Verdacht geäussert wurde, dass die eidgenössischen Obrigkeiten «mitt dem Franzossen deheinen friden wellen anna(e)men», umgekehrt aber der französische König «des willens sin so(e)lle, bÿ dem abgeredten friden von Dision zu(o)beliben». 185Urheber dieser Gerüchte war gemäss den Zeugenaussagen von Hans Schindler und Thomas Lüti Jean de Baissey, Gruyer von Burgund. Nicht einig waren sich die beiden allerdings in der Frage, ob 50 000 Kronen (Schindler) oder bereits über die Hälfte der im Dijoner Vertrag zugesagten 400 000 Kronen (Lüti) ausbezahlt worden waren. 186
Die Ereignisse im Umfeld des Dijonerzuges hatten in Solothurn ein längeres Nachspiel zur Folge, das hier nur kurz umrissen werden soll: Gerold Löwenstein, Kaufmann aus Solothurn und Schwager des Berner Junkers Ludwig von Erlach sowie des Berner Löwenwirts Michel Glaser, 187befand sich 1514 auf einer Handelsreise nach Dôle, um Schweine zu kaufen. 188Am 11. Februar wurde in Bern bekannt, dass sich Löwenstein in Dijon aufgehalten hatte. Dort soll er von La Trémoille erfahren haben, dass der König den Frieden halten und den geschuldeten Sold ausrichten wolle. 189Am selben Tag erging ein Schreiben gleichen Inhalts von Bern an Solothurn. Ausserdem enthielt dieses den Hinweis, dass er dies angeblich mit «schrifften unnd schin» belegen könne. 190Eine weitere Meldung in dieser Sache erreichte Solothurn ebenfalls an diesem Samstag im Februar aus Huttwil. Der dortige Schultheiss Wilhelm Schindler informierte den Solothurner Rat über den genauen Auftrag, den Löwenstein von Frankreich erhalten haben soll: «Er so(e)lle eis tu(o)n und so(e)l illentz wider hin us ritten fu(e)r die gmeinen in der eygnoschaftt und inen semlich meinung zu(o) erkennen geben und welle ein gmein dem frantzosen ein gleitt gen, so wellen sy har uss kon und wellen mitt dem gmeinen man under ston ein friden zu(o) machen, den sy wüssen mitt den heren nütt zu(o) machen, der küng der ko(e)nni innen nitt geltz genu(o)g geben, do mitt sy zu(o) friden sigin.» 191Der Verdacht bestand also darin, dass nicht der französische König an der Missachtung des Dijoner Friedensvertrags Schuld trage, sondern dass die Geldgier der eidgenössischen Eliten die Einhaltung des Friedens behindern würde. 192Ein Brief des Herzogs von Bourbon, der an der Zürcher Tagsatzung am 16. Februar 1514 verlesen wurde, enthielt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der König beabsichtigt hätte, den Vertrag zu halten. Bourbon verlangte lediglich Geleit, um einen neuen Frieden auszuhandeln. 193Es ist nicht eindeutig zu klären, inwiefern Frankreich an diesen Geschehnissen überhaupt Anteil hatte. 194
Löwenstein setzte die Solothurner Obrigkeit über seine Begegnung in Frankreich in Kenntnis und machte sich daran, in Balsthal eine Gemeinde einzuberufen. Die Balsthaler waren jedoch skeptisch und verlangten schriftliche Nachweise. Ein Dokument, das die Aussagen Löwensteins offiziell bestätigen würde, soll sich zu diesem Zeitpunkt in Frankreich befunden haben. Löwenstein, so die spätere Aussage von Hans Gerber, Untervogt zu Falkenstein, habe es bei seinem ersten Aufenthalt in Frankreich jedoch nicht gewagt, das brisante Schreiben an sich zu nehmen. Er befürchtete, «alz er durch keysers land ryten mu(o)ste, man mo(e)cht in an ein ast hengken». 195In Begleitung von Bernhard Sässeli und Bernhard Gerber zog Löwenstein erneut nach Frankreich, worauf Sässeli mit einem Schreiben des Herzogs von Bourbon nach Solothurn zurückkehrte. 196Der Inhalt des Schreibens entpuppte sich aber als bedeutungslos. Sässeli liess das vermeintliche Beweisstück vom solothurnischen Stadtschreiber übersetzen. Es wurde schnell klar, «daz Gerolds red unnd der brieffe nit glich stünden unnd daz die erber lüte allenthalben verfürt wurdent.» 197Davon unbeirrt ritt Sässeli nach Balsthal und besprach sich mit der dortigen Gemeinde, die jedoch mit dem auf Französisch verfassten Schreiben nicht viel anzufangen wusste. Sässeli verzichtete wohlweislich darauf, die Balsthaler Untertanen über die Einschätzung des Solothurner Stadtschreibers zu informieren. Gerber aber würde, versicherte er, ebenfalls Briefe und Siegel des Königs vorlegen. 198Als dieser in der Nacht vom 6. auf den 7. März 1514 mit leeren Händen aus Frankreich nach Balsthal zurückkehrte, entsandte man Boten, um das von Gerber in Frankreich zurückgelassene Schreiben nach Balsthal zu bringen. Bern nahm die Boten jedoch in Grandson gefangen und schickte gemeinsam mit Solothurn eine Delegation nach Balsthal. Gleichzeitig liess die Tagsatzung die Balsthaler Untertanen wissen, «Gerold Löwenstein und Bernhart Sässeli wärent verlogen, verdorben lüt unnd triben verräterisch luginen». 199Man vermutete hinter der Aktivität Löwensteins und Sässelis den Versuch des Königs, illegal Söldner anzuwerben. Tatsächlich waren die Kriegsabsichten Frankreichs in der Eidgenosseschaft zu diesem Zeitpunkt bekannt. 200Die Unruhen in Solothurn erfassten zwischen März und Mai 1514 erneut auch Luzern und Bern. 201Die Tagsatzung fasste deshalb den Beschluss, Löwenstein und Sässeli unverzüglich festzunehmen. 202Nachdem sich in Lostorf (Verweigerung der Burgrechtsbeschwörung) und in Kestenholz erneut offener Widerstand formiert hatte 203und Reden über einen erneuten Zug der Untertanen bis nach Solothurn durchgedrungen waren, 204plante Solothurn ein militärisches Vorgehen gegen die unruhigen Untertanen. Bern gelang es jedoch, die solothurnische Obrigkeit von diesem Vorhaben abzubringen. 205Am 13. Mai 1514 kam es unter Beizug der eidgenössischen Boten zu einem Ausgleich mit den aufständischen Herrschaften Falkenstein, Bechburg sowie denjenigen, die steuerlich Lostorf angehörten. Der Einigungsvertrag regelte Fragen zu Burgrecht, der Leibeigenschaft, Steuer und Allmend und legte eine Bestrafung für Straumann, Sässeli und Löwenstein fest. Unter der Bedingung, in Zukunft keine der Stadt loyal gesinnten Untertanen zu verfolgen, gingen die Anführer der Aufstände straffrei aus. 206
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Geld, Krieg und Macht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Geld, Krieg und Macht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Geld, Krieg und Macht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.