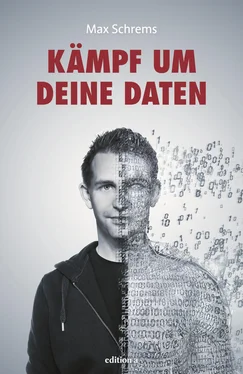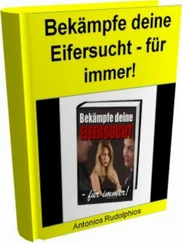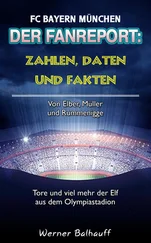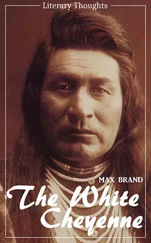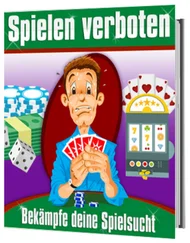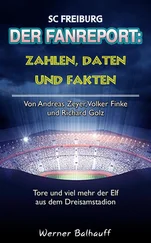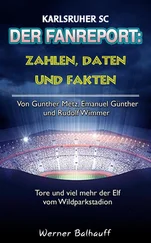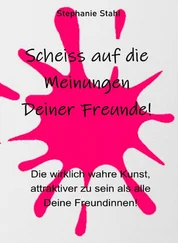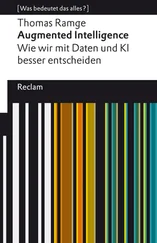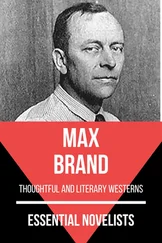Ähnlich verhielt es sich traditionell mit der Kreditwürdigkeit. Früher bekamen Menschen keinen Vertrag oder keine Mietwohnung, weil sie einen schlechten Eindruck hinterließen oder gar ihr Ruf ruiniert war. Heute wird ihr Ruf strukturiert und digital ruiniert. Der moderne Pranger sind die Datenbanken von Kreditauskunfteien oder irgendwelche Warnlisten. Dort werden Menschen von Unternehmen gebrandmarkt. Offene Rechnungen oder Zahlungsverzüge sind dort für alle verbundenen Unternehmen einsehbar. Dabei muss der Eintrag noch nicht mal richtig sein. Oft landen dort auch falsche Informationen, denn überprüfen kann man die eingehenden Informationen oft nicht. Wer aber einmal gelistet ist, spürt schnell die Macht der Daten. Kein Handyvertrag und kein Kredit sind mehr zu bekommen. Die Kreditkarte wurde leider auch nicht verlängert. Die Macht der Daten wird hier schnell sehr real, auch wenn die Betroffenen oft keine Ahnung haben, was passiert und warum sie auf einmal gemieden werden. Ihr Gegenüber hat in ihre Pokerkarten gesehen oder glaubt zumindest, diese zu kennen. Das Spiel ist für sie erst mal aus. Das Informationsgefälle resultiert, gepaart mit der Marktmacht vieler Unternehmen, in massiven Einschränkungen Ihrer alltäglichen Freiheit.
Natürlich geht es noch viel subtiler. Informationen müssen gar nicht aktiv eingesetzt werden. Allein zu wissen, dass jemand anderer etwas weiß, kann uns beeinflussen. Wenn auf Demonstrationen die Polizei alle Teilnehmer mit Kameras aufzeichnet, kann das viele von der Teilnahme abhalten. In anderen Fällen legt man sich mit einem Gegner, der intime Informationen hat, lieber gar nicht erst an. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber am Pokertisch weiß, was ich in der Hand habe, versuche ich gar nicht mehr zu bluffen. Es ist wie bei einem Hund: Man muss gar nicht immer an der Leine ziehen, der Hund muss nur wissen, dass sie da ist, um sich zu fügen. Es reicht oft sogar aus, dass der Hund glaubt, dass es eine Leine gäbe. Die Machtausübung muss also überhaupt nicht so brachial sein, wie man sich das im ersten Moment vorstellt.
Wenn nun aber Informationen Macht sind und daher Informationen über eine Person Macht über diese Person, wie kann man dieses Machtgefälle ausgleichen? Ich denke, es ist im Prinzip nicht viel anders als bei der Macht durch andere Ressourcen: Wir müssen umverteilen.
In diesem Credo lässt sich viel von der netzpolitischen Debatte um Information und Datenschutz zusammenfassen. Den meisten Menschen geht es um so etwas wie die soziale Informationswirtschaft als Abkömmling der sozialen Marktwirtschaft im Informationszeitalter. Eine Umverteilung im Informationszeitalter bedeutet einerseits Transparenz bei den Datensammlern und andererseits Schutz der Nutzer. Wie bei der sozialen Marktwirtschaft kann man natürlich endlos streiten, wie viel Information wir umverteilen müssen und wie man das am besten umsetzt. Darauf wird es auch nie eine finale Antwort geben. Die Unternehmen werden natürlich von »Robin-Hood-Manieren« sprechen und ihre total legale Machterlangung durch Leistung und Strategie vorschieben.
Wenn wir uns aber generell einig sind, dass wir in einem Informationszeitalter leben und daher auch von einer Informationswirtschaft ausgehen, dann können wir nicht so lange Daten Monopoly spielen, bis wenige die Macht über das ganze Spiel erlangen. Denn anders als bei Monopoly können wir das Spiel nicht einfach hinschmeißen, wenn es kippt. Weil eine entwickelte Demokratie auf einer breiten Akzeptanz aller Teilnehmer basiert, müssen wir einen Modus finden, der dauerhaft für alle Spieler akzeptabel ist und nicht nur einen alleinigen Gewinner kennt. Daten-Monopoly ist jedenfalls kein solcher Modus.
6. Man könnte paranoid werden
Schleichend wird unser Leben digitalisiert, heute gibt es nur wenig, das nicht irgendwie erfasst wird. Neben Schlüssel und Geldtasche darf unser Handy nie fehlen, wenn wir das Haus verlassen. Wobei mein Handy heute mehr Rechenleistung und Speicherplatz als mein alter PC hat und insofern eher ein kleiner Computer mit Telefonfunktion ist. Der GPS-Chip ist im Handy schon dabei. Die Kamera und unzählige andere Sensoren machen die Handy-Apps glücklich, die ohne Zugriff auf alle möglichen Daten, die sie eigentlich nicht brauchen, leider nicht installiert werden können.
In den Bussen, Zügen oder U-Bahnen, an öffentlichen Plätzen und in praktisch jedem Geschäft werden wir von Kameras gefilmt. Wir haben Millionenbeträge in omnipräsente digitale Augen investiert. Die Kameras im Supermarkt halten dann auch messerscharf fest, ob wir Granny Smith oder Golden Delicious in den Einkaufswagen gelegt haben. Obstdiebstahl ist schließlich ein massives Problem unserer Gesellschaft. Trotz der lückenlosen Überwachung werden wir an der Kasse trotzdem gefragt, ob man auch noch in unsere Tasche schauen kann.
Unsere Autos sammeln nicht nur selbst Daten über ihre Nutzung, sie werden auch bei der Durchfahrt jeder digitalen Mautstelle vermessen und erfasst. Mit etwas Glück wird mittels Kennzeichenerfassung über weite Strecken gemessen, ob wir nicht zu schnell fahren. Die sogenannte »Section Control« freut den Verkehrsminister und den Finanzminister zu gleichen Teilen. Den Rest erledigen die Radarboxen. Versicherungen wollen schon längst digitale Boxen in unseren Autos installieren, um unsere Bewegungen zu speichern. Unsere Navigationssysteme sagen dem Hersteller schon heute wo, wann und wie schnell wir unterwegs sind.
Unsere Arbeitszeit wird elektronisch erfasst und je nach Job auch unsere Leistung. Ein Mitarbeiter im Call Center wird ja schließlich nicht für gute Beratung bezahlt, sondern für die Abfertigung möglichst vieler lästiger Kunden pro Stunde. Leistung ist inhärent messbar.
Alle Verbindungen unserer Telefone werden sowieso mittels Vorratsdatenspeicherung protokolliert, bis hin zum genauen Ort, an dem wir uns befinden. Der Terrorismus ist ja bekanntlich im täglichen Leben jedes Mitteleuropäers ein ständiger Begleiter, vor dem wir uns erst ganz fest fürchten müssen, damit wir dann Biertischpolitiker für die Bereitstellung einer einfachen Lösung wählen.
Im Fitnessstudio bekommen wir kleine Speicherschlüssel, auf denen jede Bewegung gespeichert wird, damit wir uns selbst vermessen können. Der Trainer weiß beim nächsten Gespräch genau, dass wir die Übungen ignoriert haben, die wir eh nie machen wollten. Unsere Freunde kaufen sich sogar Laufschuhe und Armbänder, die jeden Schritt messen, auch wenn sie an ihrem Bauchumfang sehr viel leichter messen könnten, dass sie noch nicht am Ziel sind.
Je nach Anbieter wird der Inhalt jeder E-Mail, die wir versenden, analysiert und nach Verwertbarem durchsucht. Auch wenn wir selbst keinen solchen Anbieter nutzen, reicht es, wenn unsere Gesprächspartner das tun, damit unsere E-Mails im System landen. Wenn wir etwas Glück haben, dann hat unser Arbeitgeber, unsere Schule oder unsere Universität sowieso schon ihre eigene Infrastruktur aufgegeben und unsere Daten in die Cloud eines IT-Konzerns verschoben.
Unsere Zahlungen werden bei verschiedenen Kartenfirmen und Banken genau verfolgt. Kreditauskunfteien legen ohne unser Zutun umfangreiche Informationen über uns an und sammeln dabei Daten von unzähligen Stellen. Sie berechnen irgendwelche Kennzahlen, die unsere Zuverlässigkeit beschreiben sollen.
Wir arbeiten nicht nur am Computer, sondern verbringen auch immer mehr von unserer Freizeit im Internet oder vor dem PC. Fast jede Seite, die wir im Netz besuchen, verfolgt uns, zeichnet Interessenprofile auf und will wissen, was wir tun. Die großen Online-Unternehmen verfolgen uns auf fast allen Seiten im Netz, denn ihre Dienste sind im Hintergrund fast überall integriert. Die Software auf unserem Computer oder Handy verfolgt uns sowieso, viele der zusätzlichen Apps sind nur dafür gemacht.
Unsere Freunde stellen Informationen über uns online oder stellen ihre gesamten Adressbücher überhaupt ohne unser Wissen irgendwelchen Unternehmen zur Verfügung. Wir bekommen am Ende E-Mails von Firmen, mit denen wir nie etwas zu tun hatten.
Читать дальше