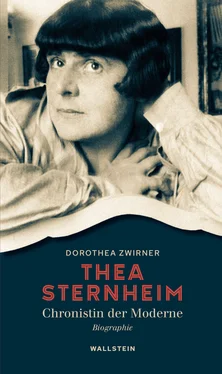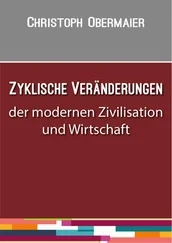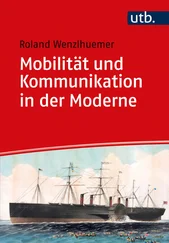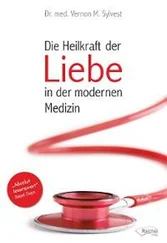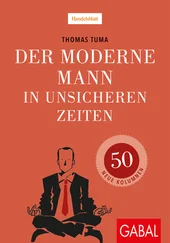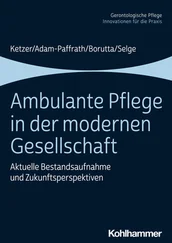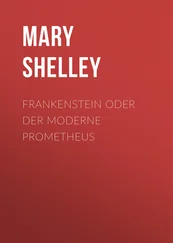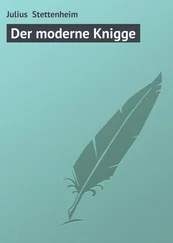Unglücklich, aber motiviert von Theas Ermutigungen und seinen neuen Eindrücken kehrt Carl im Februar nach Freiburg in sein altes Hotel zurück, wo er sich sogleich in die Arbeit am zweiten Teil seines Don Juan stürzt. Dafür beginnt er sich mit Philosophie zu beschäftigen, die er sich im brieflichen Austausch mit Thea anzueignen gewöhnt. Wie in einem Fernstudium profitiert sie von seinen Reflexionen und Einsichten und entfaltet ein ganz neues Lebensgefühl:
»[…] Positives Leben. Nicht nach fühlen, mit fühlen – aber selbst fühlen! Ohne Vorurteil! Ohne Bedenken!
Ich vertiefe mich in Deine Arbeit! Aber was soll mir das? Was soll mir das im Letzten. Das kommt alles von der Liebe her und die Liebe ist wol auch das Schönste, das wir haben –
Aber das Leben geht vor, ich gehe vor! Ich! Jeder steht sich selbst am nächsten! Du hast Dir immer am nächsten gestanden! Gott sei Dank!
[…] O wie ist das Leben schön! Mit Dir! Versteh wol: Mit Dir!
Nicht: Für Dich!
Aber mit Dir.«[80]
In dieser Zeit lernt sie den jungen Getreidehändler Alfred Flechtheim kennen, der sich für zeitgenössische Kunst interessiert und bereits eine beachtliche Sammlung grafischer Blätter zusammengetragen hat. Thea ermuntert ihn, statt mit Getreide doch lieber mit Kunst zu handeln. Sie selber spielt mit dem Gedanken an ein eigenes Theater und den damit verbundenen Möglichkeiten einer beruflichen Tätigkeit:
»[…] Du mußt das nicht falsch verstehen.
Ich lebe für Dich?! – Nein – ich bin viel zu viel Kraftmensch dazu, um für Dich zu leben. Das geht mir ab; das Zudiraufschaun, das Anbeten! Hab’ ich Dich darum weniger lieb!? Ich vergleiche. Ich lebe mit Dir!
Ich ändere kein Wort daran. Aber ich liebe Dich über meine Grenzen.«[81]
Trotz Theas grenzüberschreitender Liebe und ihrem unermüdlichen Einsatz und Enthusiasmus für seine Arbeit schwankt Carl immer wieder zwischen Schwermut und Größenwahn hin und her. Die fernbleibende Geliebte und der ausbleibende Erfolg zermürben ihn gleichermaßen. Thea kann dagegen die Heimlichkeiten und Lügereien nicht länger ertragen und offenbart sich Eugenie.
»Ich habe heute seiner Frau mein Letztes gesagt, dass die kleine Thea sein und mein Kind ist, dass ich ihm schreibe und dass ich ihn liebe, Gott so sehr liebe. Ich bin von Grund auf wahrhaftig gewesen.
Was mir auch diese Eröffnungen bringen werden, ich will diese Stunde segnen. Und seine kleine Frau ist mir sehr nah gekommen, ich will sie immer lieb haben.
In diesen Monaten ist viel geworden und auch nicht geworden.
Meine Gedanken waren oft nicht rein. Ich habe an Karl gezweifelt, ihn mit Bewusstsein gekränkt. An diesem Abend aber ist mein Herz krystallklar, weil ich der Wahrheit ihr Teil gegeben.
Ich bin viel ausgegangen und habe bei den Männern Erfolg gehabt. Ein gewisses Gefühl der Befriedigung überkommt mich bei ihren Bemühungen und wenn ich sehe, wie ich andere Frauen durch mein Äusseres und meine Persönlichkeit in Schatten stelle. Jedes Wort, das ich spreche, jede kleine Gebärde ist auf Wirkung berechnet. Auf meine Kleidung lege ich grossen Wert und gebe viel Geld aus.
Da mir die Kraft fehlt, mich zu sammeln, zersplittere ich mich an hundert Kleinigkeiten.«[82]
Selbstkritisch geht Thea mit sich ins Gericht, denn nur schonungslose Wahrheit schafft ihr Erleichterung, die ihr fortan zur Maxime ihres wieder aufgenommenen Tagebuchs wird. Doch schon am nächsten Tag erreicht sie eine kurze unverständliche Nachricht von Carl aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg. In größter Sorge erfährt sie erst Tage später über seinen Freund und Anwalt Benndorf von dem vertrauenerschütternden Vorfall, der Sternheim für drei Monate in die geschlossene Anstalt bringt. Ein groteskes Sittlichkeitsdelikt an einer jungen Frau wird ihm zur Last gelegt, die aus Schreck vor seinem Ansinnen, ihn auf Knien anzubeten, aus dem Fenster gesprungen sei und beide Beine gebrochen habe. Was auch immer im Einzelnen vorgefallen sein mag, Thea bewahrt ihren kühlen Kopf und lässt den Patienten nichts von ihrer Erschütterung fühlen. Im Wahnsinn fordert das Genie seinen Tribut, den Thea zu zahlen bereit ist, unternimmt sie doch selbst gerade eigene Schreibversuche.
»[…] ich schreibe seit Wochen an einem Theaterstück, das der größte Mist ist, der mir je vorgekommen und Tristan und Isolde heißt.
Wenn es fertig ist, wandert es ins Feuer oder ins W. C. Aber erst muß ich es fertig haben; sonst komme ich nicht zur Ruhe.
[…] Wenn ich ein Mann geworden wäre, hätte ich es zu etwas bringen können. – Das ist sicher! Aber so! – Eine minderwertige Person. Halbheiten, Träume, die sich nie erfüllen werden und eine tolle Sehnsucht!«[83]
Immerhin erfüllt sich für Thea eine andere lang gehegte Sehnsucht, denn sie unternimmt im April ihre erste Parisreise mit Arthur, Flechtheim und anderen Bekannten. Auch wenn sie diese Reise lieber mit Carl unternommen hätte, erlebt sie die beglückende Anziehung der französischen Kulturmetropole, die ein Leben lang anhält. Die japanischen Kirschbäume vor Notre-Dame stehen in überschäumender Blüte als feierten auch sie die gotische Synthese aus Rationalität und Transzendenz, von der sich Thea so sehr angezogen fühlt. Zudem erweist sich Flechtheim als kundiger Führer durch die Galerien der pulsierenden Kunststadt. Doch auch dieser kurze Glücksmoment wird abrupt unterbrochen durch die Nachricht von der plötzlichen Krankheit ihres Vaters. Sofort reist Thea zurück nach Köln, wo Georg Bauer zwei Tage darauf am 19. April 1906 verstirbt. Kaum ein Jahr ist seit dem Tod ihrer Mutter vergangen, als die 22-jährige Thea auf einmal ohne Eltern, aber als reiche Erbin dasteht. Mit gemischten Gefühlen versucht sie sich über ihre veränderte Lebenssituation klar zu werden:
»In mir mischen sich zwei Gefühle: eine aufrichtige Trauer um den Verstorbenen und andererseits ein Gefühl des Befreitseins, dessen ich mich schäme. Aber dies Gefühl ist so stark und so wahrhaftig, dass all mein Sträuben dagegen nutzlos bleibt. Ein Mensch weniger, auf den ich Rücksicht nehmen brauche, wenn es gilt, meinen Weg zu gehn.
Die Zeit darauf Auseinandersetzungen zwischen Arthur und meinen Brüdern, zwischen uns Kinder[n] und Schaurte. Theo bleibt im Elternhaus wohnen. Meine Brüder kommen zum erstenmal zu uns und wir fahren auch nach Köln und Noithausen.
Die Kinder sind gesund. Ich habe Moibylein fünfzehn Monate lang genährt.
Mit Arthur geht es auch leidlich. Er hat viel mit der Erbschaftsangelegenheit zu tun.
Ich sehne mich nach Karl. Es gelingt mir auch, Arthur zu bestimmen mich für den Juli mit den Kindern und Wilhelmine fortzulassen.«[84]
Thea und ihre beiden Brüder erben sechs Millionen Mark, was einer heutigen Kaufkraft von ungefähr 36 Millionen Euro entspricht. Mit der endgültigen Loslösung von ihren Eltern, der Entwöhnung des Säuglings und einem Vermögen von rund zwölf Millionen Euro steht Theas Wunsch nach Selbstbestimmung im Prinzip nichts mehr im Wege. Auch Carl ist bald ein freier Mann, denn Eugenie und Douglas haben belastende Briefe von Thea an Carl als Beweismaterial bei einem Münchner Anwalt hinterlegt, um die Schuldfrage im Scheidungsfall zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Ankündigung der Scheidung setzt Carl jedoch so sehr unter Druck, dass er nun seinerseits Thea gegenüber auf eine Entscheidung pocht. Voller Neid vergleicht er ihr familiäres Dasein mit seinem unsteten Lebenswandel, der letztlich zu dem Freiburger Desaster geführt habe und dringend einer dauerhaften Änderung bedarf. Carls Eltern schlagen vor, dass er zwecks Erholung zunächst wieder ins Elternhaus nach Berlin zieht. Thea unterstützt jedoch Carls Wunsch, ein eigenes Häuschen in Bremen für ihn zu mieten und einzurichten, worüber sie sogar mit Carls Vater korrespondiert. Sorgen bereiten aber nicht nur Carls psychische, sondern auch seine finanziellen Probleme. Überall sind Schulden aufgelaufen bei Ärzten, Rechtsanwälten, Hotels, Buchhandlungen, Schneidern sowie Steuerschulden, die teilweise sein Vater, dann aber vor allem Thea übernimmt.
Читать дальше