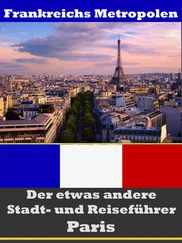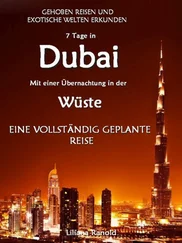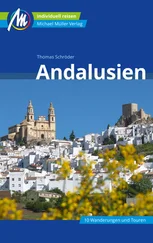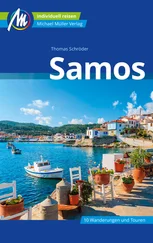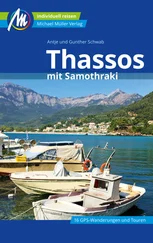Teambildung benötigt Zeit. Obwohl das von Tuckman definierte Phasenmodell bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren hat, ist der Druck auf Teams, in immer kürzeren Zyklen mehr Ergebnisse zu liefern, gestiegen. Haben Unternehmen heute also noch Zeit für Teambildung? Kann das Thema Teambildung beschleunigt werden? Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer häufiger gebraucht wird, ist der des Empowerments. Führungskräfte geben dabei einen Teil ihrer Entscheidungshoheit auf und übertragen diesen auf ihre Mitarbeitenden. Dadurch, dass Teams bestimmte Entscheidungen innerhalb der Gruppe treffen dürfen, wird die Motivation gesteigert, was sich positiv auf die Lieferung von Ergebnissen auswirkt und gleichzeitig die Dauer des Teambildungsprozesses verkürzen kann. Dieser zuerst einfach anmutende Weg birgt jedoch Konfliktpotenzial. Mal abgesehen davon, dass viele Führungskräfte diesem Prinzip misstrauen, weil sie dadurch selbst weniger „mächtig“ sind und befürchten, Kontrolle zu verlieren, müssen Mitarbeitende erst lernen und wollen, Entscheidungen zu treffen. Um dies zu erreichen, sind zunächst noch weitere Schritte notwendig.
General Stanley McChrystal beschreibt in seinem Buch Team of Teams ein einfaches Konzept, das den Zusammenhang zwischen Komplexität und Anpassungsfähigkeit verdeutlicht. Diese zwei Aspekte sind es, die agile Entwicklungsmethoden wie Scrum so beliebt gemacht haben. Obwohl dem Buch ein militärischer Hintergrund zugrunde liegt, sind die Erkenntnisse durchaus auf Scrum Teams anwendbar. Komplexität wird in diesem Modell maßgeblich durch die Komponenten Geschwindigkeit, also die sich rasend schnell ändernden Umweltbedingungen, und gegenseitigen Abhängigkeiten derselben bestimmt. Um auf diese komplexen Probleme reagieren zu können, braucht es ein anpassungsfähiges Team. Dieses wird wiederum durch ein gemeinsames Bewusstsein innerhalb des Teams sowie durch Empowerment der Teammitglieder erreicht. Entscheidend ist dabei, dass eine gewisse Reihenfolge berücksichtigt wird. Zunächst sollte ein gemeinsames Bewusstsein geschaffen werden. Erst mit dieser einheitlichen Basis kann innerhalb eines Teams Empowerment stattfinden. McChrystal geht in seinem Buch sogar noch weiter, wenn er schreibt, dass Empowerment ohne ein gemeinsames Bewusstsein gefährlich sei. Er führt als Beispiel die Finanzkrise 2008 an, die zu einem großen Teil von jungen, unerfahrenen Bankern ins Rollen gebracht worden war, die zu viel Entscheidungsspielraum und zu wenig Anleitung bekommen hatten. Empowerment funktioniert demnach nicht, wenn innerhalb einer Organisation oder eines Teams die Verantwortung einfach „nach unten“ geschoben wird. Es ist sogar in hohem Maße gefährlich. Vielmehr müssen die Teammitglieder bereit und willens sein, Verantwortung zu übernehmen. L. David Marquet beschreibt diesbezüglich eine Episode in seinem Buch Turn the Ship Around!, in der sich Abteilungsleiter beim Executive Officer abmelden und fragen, ob es für sie noch etwas zu tun gäbe. Die Verantwortung für die Arbeiten der Abteilungsleiter bleibt damit laut Maquet beim Executive Officer. Vielmehr sollten Abteilungsleiter erklären, was sie bereits geschafft haben und was sie planen, als nächstes zu tun. Marquet bezeichnet das als „Leadership at all levels“ oder Intent-based Leadership, womit wir erneut beim Thema Selbstorganisation wären. Die beiden wichtigsten Zutaten, die den Kern des Konzepts von McChrystal bilden, fehlen jedoch noch. Diese sind ein gemeinsames, sinnhaftes Ziel und Vertrauen. Nur wenn alle Teammitglieder das gemeinsame Ziel kennen und teilen und den Sinn darin verstehen, können sie die einzelnen Stärken zielgerichtet einbringen und auf Aktionen anderer entsprechend reagieren. Dies erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen innerhalb des Teams.
Wie wichtig Vertrauen unter Teammitgliedern ist, um Höchstleistungen erzielen zu können, ist auch daran erkennbar, dass Vertrauen die grundlegende Funktion im Modell von Patrick Lencioni ist. Es beschreibt fünf Funktionen und Dysfunktionen von TeamsDysfunktionen von Teams, die in Abbildung 8 dargestellt sind. Dieses Modell dient der Standortanalyse im Rahmen von Teamentwicklungsprozessen. Dabei gilt es Funktionen sicherzustellen und Dysfunktionen zu beenden, denn in dem Maße, wie sich Funktionen positiv auf die Leistungsfähigkeit von Teams auswirken, können Dysfunktionen den nachteiligen Effekt haben.
 Abbildung 8:
Abbildung 8:
Fünf Dysfunktionen von Teams
Vertrauen
Amy Edmundson, Professorin für Leadership an der Harvard Business School, hat den Begriff „psychologische Sicherheit“ geprägt. Damit beschreibt sie ein Umfeld des Vertrauens, in dem sich Teammitglieder sicher fühlen. Ihre Forschung hat ergeben, dass in solchen Teams vermeintlich mehr Fehler gemacht werden als in Teams, in denen kein gegenseitiges Vertrauen vorherrscht. Das ist allerdings ein Trugschluss. In Wahrheit hat das Umfeld der psychologischen Sicherheit zu einem anderen Umgang mit Fehlern geführt. Diese wurden offener angesprochen und das Team hat als Ganzes daraus gelernt. Es entstand eine offene Fehlerkultur, die am Ende zu hochperformanten Teams führen kann. Im Gegensatz dazu werden in Teams, in denen diese Kultur fehlt, Fehler und Missstände eher verheimlicht und vertuscht, was sich am Ende nachteilig auf das gesamte Team auswirkt.
Konfliktbereitschaft
Konflikte sind per Definition nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, sie sind notwendig, um Neues entstehen zu lassen und Innovation voranzutreiben. Dieses Bewusstsein zu schärfen, ist ein wichtiger Bestandteil von Hochleistungsteams.
Selbstverpflichtung
Selbstverpflichtung bedeutet, sich als Teammitglied zur gemeinsamen Sache zu bekennen. Es beinhaltet auch, Verantwortung für das Team und das gemeinsame Ziel zu übernehmen. In Hochleistungsteams halten sich Teammitglieder keine Hintertüren offen. Das gemeinsame Ziel ist wichtiger als individuelle Ziele. Es gilt demnach, den Gemeinschaftssinn zu stärken.
Gegenseitige Verantwortlichkeit
Darf man sich in die Angelegenheiten anderer Teammitglieder einmischen? Im Sinne des gemeinsamen Ziels ist dies sogar erwünscht, sollten Beiträge einzelner nicht zielführend sein. Das gemeinsame Lernen und Erreichen des Ziels stehen im Vordergrund. Natürlich entwickelt sich dadurch eine gewisse Gruppendynamik, die zunächst irritieren mag, vor allem, wenn man als einzelner nicht daran gewöhnt ist. Da sich Anforderungen in heutiger Zeit rasend schnell ändern können, ist es notwendig, mit diesen zu wachsen, und zwar zusammen, da die Komplexität vieler Anforderungen die Zusammenarbeit vieler benötigt.
Zielorientierung
Klare und eindeutige Zieldefinitionen vermeiden, dass Status und Ego einzelner zu sehr wuchern. Vermehrt hört man heutzutage, dass auf Grund von Agilität klare und eindeutige Zielformulierungen nicht möglich sind. Das ist schlichtweg nicht richtig. Natürlich ist es nicht einfach, aber ein wesentlicher Teil von Führung – und das beschränkt sich nicht auf einen rein agilen Kontext – bedeutet auch, dem Team Sinn und Orientierung in der Arbeit zu vermitteln. Das kann in der Praxis beispielsweise durch eine klare und offene Kommunikation geschehen, wobei natürlich inhaltlicher Kontext genauso wichtig ist.
5 Scrum Artefakte – Die Übersicht behalten
Die Scrum ArtefakteScrum Artefakte gibt es inzwischen seit 25 Jahren und sie haben bis heute nicht an Bedeutung verloren. Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, werden im aktuellen Scrum Guide die Artefakte Product Backlog, Sprint Backlog und Produktinkrement unterschieden. Mit dem Scrum Guide 2020 gibt es nun eine klare Zuordnung von Vereinbarungen („Commitment“) zu diesen drei Artefakten (siehe Abbildung 9).
Читать дальше

 Abbildung 8:
Abbildung 8: