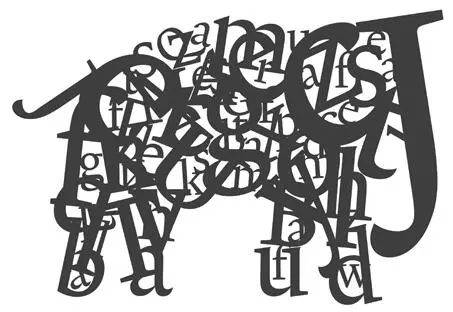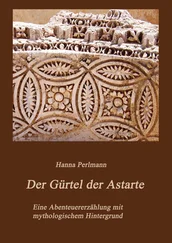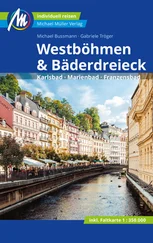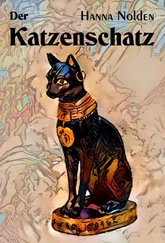Hanna Molden
Der Jahrhundertelefant
Eine literarische
Familienbiografie

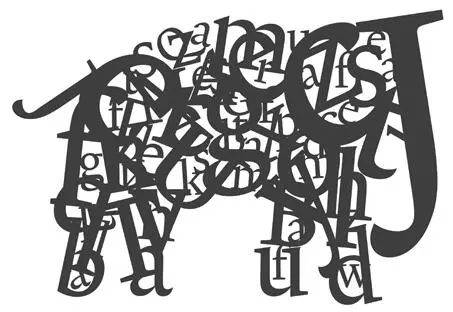
Jakob und der kleine Bub
Jakob und der wilde Kerl
Jakob und der alte Mann
Der Jahrhundertelefant
Zeittafel
Warum ich die Geschichte erzähle?
Nun, Familien haben Geschichten.
Es gibt keine Familie, die nicht ihre eigene Geschichte hätte. Die Familie Molden, in die ich vor mehr als fünfzig Jahren geheiratet habe, verfügt über ein ganzes Netzwerk von Geschichte und Geschichten.
In dieser Familie wird seit mehreren Generationen Geschichte als Wissenschaft betrieben. Es wurden Gedichte und Romane verfasst. Es werden Sachbücher geschrieben. Es werden Lieder erdichtet. – Und was nicht geschrieben steht, erzählt man sich. Von Generation zu Generation.
So auch die Geschichte von einem Elefanten namens Jakob. Eine interessante Persönlichkeit, dieser Jakob, der eines schönen Tages in der Familie Molden aufgetaucht ist und die Kindheit meines Mannes Fritz Molden verzaubert hat. Dieser Jakob hat ihn ein ganzes Leben lang begleitet.
Am Ende seiner Tage hat Fritz Molden die Geschichte seines Elefanten aufgeschrieben. Es sollte ein Buch daraus werden. Dazu kam es aber nicht.
Schade, fanden viele in der Familie. Fanden Freunde. Fand ich. Es wäre eine Art von heiterem, zärtlichem, spannendem Vermächtnis geworden.
Und Vermächtnisse sollen nicht im Verborgenen bleiben.
Darum erzähle ich diese Geschichte. Auf meine Weise.
Hanna Molden
Sommer 2021
Familiengeschichte wird nie restlos erzählt, weil immer irgendwer der Wahrheit nicht ins Auge sehen will. Die eine Episode wird aufgeblasen, die andere ausgelassen. Dies trifft auch auf die Familie M. zu, deren Geschichte schon oft erzählt wurde. Meine Position in dieser Familie ist ja auch eine ungewöhnliche. Ich bin den M.s kein Onkel, kein Pate, kein Cousin. Dennoch bin ich in gewisser Weise in sie hineingeboren, und durch die daraus resultierende Nähe und meine diskrete Existenz eröffnet sich mir eine einzigartige Perspektive des Beobachters und Chronisten.
Sie werden sich fragen, wer ich denn nun bin.
Ich bin ein ziemlich großer Kerl. Man könnte auch sagen, dass ich gewaltig bin. Ich bin grau. Und faltig. Ich habe schwere Füße, und kleine Augen, von denen manche behaupten, sie seien listig. Meine Ohren sind groß. Sehr groß. Alles in allem: Ich bin eine eindrucksvolle Erscheinung. Ich bin ein Elefant.
Meine Ahnenreihe reicht bis ins Miozän zurück. Was das ist? Eine Phase des Känozoikums. Was das heißt? Die Neuzeit unserer Erde. Was am Ende bedeutet, dass es Elefanten seit rund sieben Millionen Jahren gibt. Eine stattliche Stammesgeschichte, zoologischer Uradel …
Es gibt afrikanische Elefanten und Waldelefanten und asiatische Elefanten. Aber zu denen gehöre ich nicht. Ich wurde nämlich weder im afrikanischen Busch, noch in den tropischen Regenwäldern Afrikas, noch in den Monsunregenwäldern Indiens geboren. Wo und wie ich geboren wurde, bleibt vorerst noch mein Geheimnis.
Es ist Frühling. Genauer gesagt, später April. Ein milder Abend. Die Fenster zum Garten stehen offen, ein Lüfterl bauscht die weißen Vorhänge aus Tupfbatist.
Der Bub hopst in seinem Bett auf und ab und versucht, einen Zipfel eines Vorhangs zu erwischen. Aufziehen will er ihn, sehen, was der große Bruder im Garten treibt. Er wäre auch noch gern im Garten, es ist ja noch ganz hell, die Amseln singen, was die Mama das Abendlied nennt. Und der Fußball des Bruders trifft mit dumpfem Knall gegen die Wand des Salettls. Wieder und wieder. Der Bruder übt einen Elfmeter. Und der Papa, der müsste auch bald kommen, heute ist der einzige Tag der Woche, an dem der Papa früh zum Abendessen zu Hause ist.
Er müsste jetzt schon auf dem Weg von der Straßenbahnhaltestelle sein, durch die stille Gasse gehen, wo jeder Schritt am Kopfsteinpflaster hallt. Gleich wird er vor dem gelben Haus sein. Wird durch das breite, halbrunde, graugrüne Holztor gehen, durch das früher noch Pferdefuhrwerke gefahren sind. Hat die Mia erzählt. Durch den breiten Gang wird er bis in den Garten mit den hohen Bäumen gehen, die schon zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia hier gestanden sind. Denn da, wo heute der Garten mit dem Salettl und den Rosenstauden ist, war vor zweihundert Jahren eine Allee, die von der Donau bis zu einem kleinen Lustschloss der Kaiserin führte. Hat der Großpapa erzählt.
„Guten Abend, Herr Doktor“, hört der Bub das Kindermädel Mia sagen.
Also ist der Papa schon auf der breiten steinernen Stiege, die vom Garten in den ersten Stock führt. Ha, die gläserne Tür zwischen Stiege und Wohnung scheppert, der Papa ist angekommen.
„Papa! Papa!“, schreit der Bub. Noch sind wir in der Zeit, in der gewisse Sitten und Gebräuche aus der K.-u.-k.-Monarchie üblich sind und in der Kinder in Familien wie der seinen „Papa“ und „Mama“ auf dem zweiten „a“ betonen. Wild hüpft er auf seinem Bett, sein Nachthemd ist ihm dabei etwas hinderlich, er hätte auch schon gerne einen Pyjama wie der große Bruder, aber den kriegt er erst, wenn er sechs ist. Er ist ja grad erst fünf geworden.
„Papa“, seufzt der Bub glücklich, als der Vater sich zu ihm beugt und ihn auf die Stirn küsst. Gleich wird er ihn fragen, was er heute alles gemacht hat.
„Und, Feppchen, wie war dein Tag, was hast du alles gemacht?“, fragt der Vater wie erwartet. Eigentlich heißt der Bub Fritz. Zweiter Name Peter. Fritz Peter, daraus wurde Feppchen, sein familieninterner Spitzname.
„Die Monika hat die Erna in die Hand gebissen.“ Fritz ist stolz, dem Papa eine ans Sensationelle grenzende Neuigkeit zu liefern. Der Papa ist Journalist. Chefredakteur einer sehr wichtigen Zeitung. Der hat etwas übrig für Neuigkeiten.
Es dauert eine Weile, bis der Vater die Geschichte in vollem Umfang erfährt.
Monika ist die gleichaltrige Freundin von Fritz, Nachbarskind, die Erna ist deren Kindermädel. Die Monika wollte sich von der Erna nicht an der Hand führen lassen, die Erna fasste dennoch zu, worauf die Monika die Erna in die Hand gebissen hat …
„Na so was“, sagt der Papa. Gleich wird er gehen. Im Speisezimmer wartet ja das Abendessen für die Eltern und den Bruder.
Wie wäre der Papa noch aufzuhalten? Was könnte man ihm noch erzählen, dass er noch eine kleine Weile bleibt? Fritz fixiert die lange Gestalt des Vaters, der da – im ewig grauen Zweireiher mit der ewig gleichen grauen Weste – vor ihm steht.
„Was ist das, Papa?“, fragt Fritz und deutet auf die weißen Blätter, die zusammengerollt aus der Tasche des väterlichen Sakkos ragen.
„Das?“ Der Papa muss ein wenig nachdenken. Ob er vergessen hat, was auf den Blättern steht? Dann scheint es ihm wieder einzufallen. Er nimmt die Blätter heraus, entrollt sie, sieht kurz drauf und lächelt.
„Das?“, sagt er. „Das ist ein Brief.“
„Von wem?“
Kleine Pause. „Von einem Elefanten.“
Ein Brief von einem Elefanten. Das muss der Fritz erst verdauen. Mit der Zeigefingerspitze an der Nasenspitze.
Читать дальше